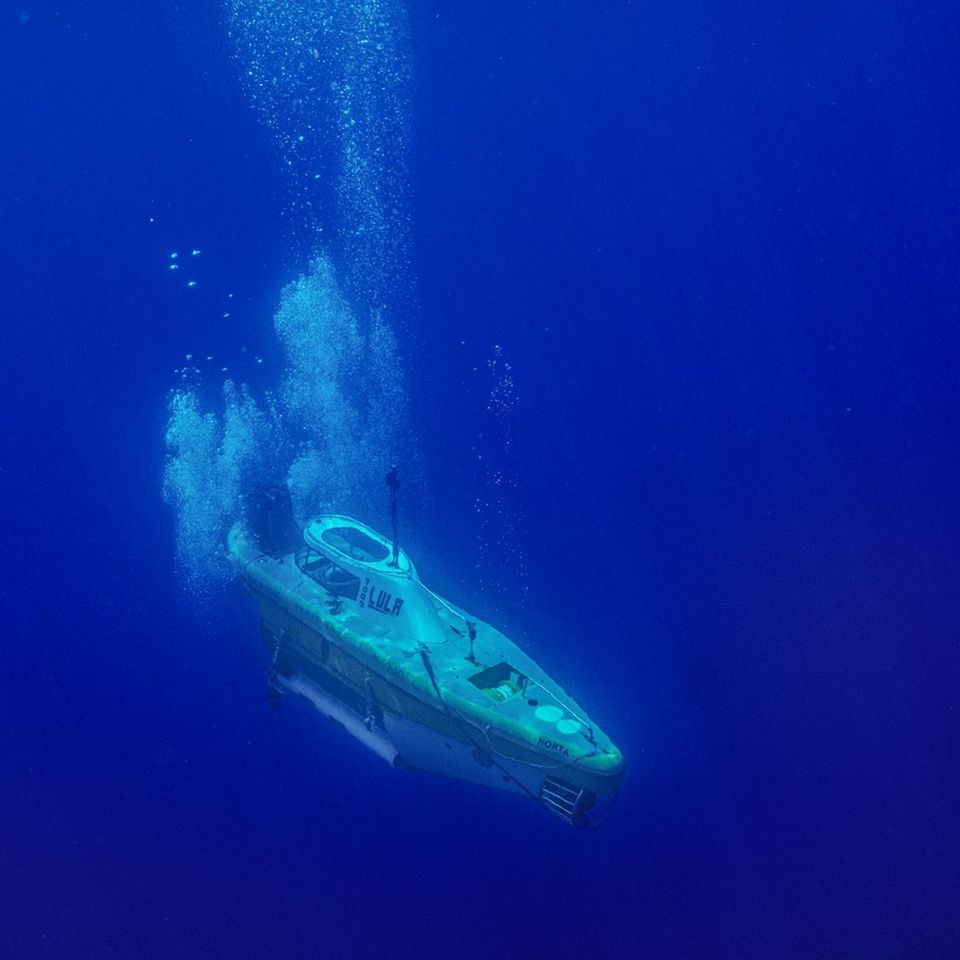Temperaturen um null Grad Celsius, ein Druck von bis zu 1000 Atmosphären, vollkommene Dunkelheit: Die Bedingungen für ein ausschweifendes Liebesleben sind in der Tiefsee nicht eben günstig. Und doch leben auch in diesen Regionen Wesen, die sich geschlechtlich vermehren. Allerdings nicht wie ihre an Land oder in den oberen Wasserschichten lebenden Verwandten. Mit einer sehr speziellen Liebesstrategie hat sich jetzt ein US-amerikanisches Wissenschaftsteam beschäftigt.
Das Problem für die Tiefsee-Anglerfische beginnt schon damit, dass es für die oft nur wenige Zentimeter messenden Männchen unter den extremen Bedingungen in mehreren Kilometern Tiefe gar nicht so einfach ist, einen weiblichen Partner zu finden – und ihn dann nicht aus den Augen zu verlieren. Einige Arten der Tiefsee-Anglerfische haben darum ein bizarr anmutendes Verhalten entwickelt: Hat ein Männchen eines der um ein Vielfaches größeren, geschlechtsreifen Weibchen gefunden, beißt es sich an ihm fest – um es erst nach dem Ablaichen wieder loszulassen. Oder gar nicht.
Das Männchen verschmilzt teilweise mit dem Weibchen
Tatsächlich, so berichten Thomas Near, Professor für Ökologie und Evolutionsbiologie an der Yale University, und sein Team, vereinigen sich Männchen und Weibchen mancher Arten unwiderruflich: Ihre Haut und ihr Blutkreislauf wachsen zusammen. Der Kopf des Männchens löst sich im Gewebe des Weibchens buchstäblich auf, und der Rest des männlichen Tieres lebt als sogenannter Sexualparasit fort – wie ein zusätzlicher Körperteil des Weibchens. Bekannt ist dieses Verhalten etwa von zwei Familien der Tiefsee-Anglerfische, den Rutenanglern (Ceratiidae) und den Teufelsanglern (Linophrynidae). Bei der Eiablage gibt das Männchen seine Spermien ab – und stirbt zusammen mit dem Weibchen. Es gibt sogar Arten, bei denen das Weibchen von mehreren Männchen parasitiert wird.
Thomas Near und sein Forschungsteam rekonstruieren in ihrer Studie, wie sich dieses im Tierreich einzigartige Verhalten entwickelt hat. Wie sie im Fachjournal "Current Biology" berichten, lieferten die Genome verschiedener Tiefsee-Anglerfische Aufschlüsse über ihre Entwicklung im Lauf der Evolution. Demnach lebten die heutigen Tiefseebewohner ursprünglich in eher flachen, warmen Lebensräumen – über deren Grund sie mit umgewandelten Brustflossen flanierten. Doch diese Gewässer wurden vor etwa 50 bis 35 Millionen Jahren im Verlauf einer extremen Erderwärmung – dem sogenannten Paläozän/Eozän-Temperaturmaximum – unbewohnbar. In der Zeit eines massenhaften Artensterbens blieb den Anglerfischen nur die Alternative: ebenfalls aussterben oder in tiefere Gewässerschichten abwandern.
Neben den Anpassungen an die Dunkelheit und den enormen Druck war es vor allem der Sexualparasitismus, der den Spezies dauerhaft die Existenz sicherte, schreiben die Autorinnen und Autoren.
Dass die körperliche Verschmelzung überhaupt möglich ist, dafür sorgt eine weitere Besonderheit der Tiefsee-Anglerfische: Ihnen fehlen Gene, die bei anderen Lebewesen dafür sorgen, dass fremde Zellen als solche erkannt und angegriffen werden. Der zugrundeliegende Mechanismus könnte auch für die Humanmedizin interessant sein: "Ein besseres Verständnis darüber, wie Tiefsee-Anglerfische ihre adaptive Immunität verloren haben, könnte eines Tages zu Fortschritten bei medizinischen Verfahren wie Organtransplantationen und Hauttransplantationen beitragen, bei denen die Unterdrückung der Immunität von entscheidender Bedeutung ist", sagt Thomas Near in einer Pressemitteilung.