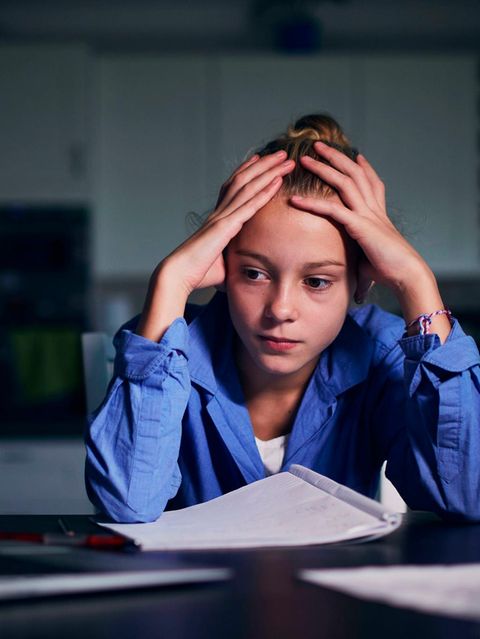Eigentlich gehören Pumas zu Patagonien wie Kängurus zu Australien oder Eisbären zur Arktis: Die Einzelgänger durchstreifen ihre weitläufigen Reviere in der kargen Steppe und machen in der Dämmerung Jagd auf Guanakos, Hirsche und Kleinsäuger. Doch mit der Ausbreitung der Schafzucht in Patagonien wurden die Pumas im 19. und 20. Jahrhundert verfolgt und vertrieben. Die Folge: Patagonien war praktisch pumafrei. Erst als um die Jahrtausendwende Schutzmaßnahmen umgesetzt wurden und Schutzgebiete wie der Nationalpark Monte León gegründet wurden, kehrten die Raubtiere zurück.
Doch in ihrer Abwesenheit hat sich das angestammte Gebiet der Pumas verändert. Nicht nur Schaffarmen breiteten sich aus, auch der Magellanpinguin (Spheniscus magellanicus) eroberte das Festland Patagoniens. Denn während die Pinguine im Wasser um ihren angestammten Lebensraum auf Inseln vor der Küste Seelöwen und Orcas fürchten müssen, hatten sie an Land lange Zeit keinerlei Feinde.
Jedenfalls bis zur Rückkehr der Pumas. Diese machen nämlich plötzlich Jagd auf Pinguine, schreibt ein internationales Forschungsteam in einer Studie im Fachmagazin "Proceedings of the Royal Society". Das hat Folgen für das Sozialverhalten der Raubkatzen: Die eigentlich einzelgängerischen Tiere kommen durch ihren veränderten Speiseplan vermehrt mit Artgenossen in Kontakt – und tolerieren diese, statt sie zu bekämpfen. Und: Ihr Revier verkleinert sich mit der neuen Beute.
Einzelgänger interagieren plötzlich
Zunächst waren die Forschenden von Einzelfällen ausgegangen, als sie im Nationalpark Monte León Pinguinreste in Pumakot gefunden hatten. Doch dann beobachteten sie immer wieder Pumas in der Nähe der Pinguinkolonie und wollten es genauer wissen: Sie installierten Kameras in der Nähe der Kolonie und trackten zusätzlich 14 Pumas mit GPS-Sendern.
Das Ergebnis: Neun der 14 beobachteten Pumas gingen regelmäßig auf Pinguinjagd. Diese Pumas verkleinerten ihr Revier und passten ihren Aktionsradius an ihre Beutetiere an: Während die Vögel von September bis April im Nationalpark brüteten, lauerten die Pumas ganz in ihrer Nähe. Zogen die Pinguine im Sommer aufs Meer, vergrößerten die Pumas ihren Aktionsradius wieder um das Doppelte.
Gleichzeitig interagierten die Pumas, die Pinguine fraßen, deutlich häufiger miteinander als ihre Artgenossen, die sich auf andere Beutetiere beschränkten. Die Forschenden beobachteten 254 soziale Interaktionen zwischen pinguinfressenden Pumas, aber nur vier Begegnungen zwischen Pumas, von denen keiner Pinguine fraß. Das werten die Forschenden als ein Hinweis auf eine größere soziale Toleranz der Pinguinfresser.
Die Forschenden begründen das mit der Hypothese der Ressourcenverteilung, wonach reichlich vorhandene und konzentrierte Ressourcen zu größerer Sozialität und einer höheren Populationsdichte von Raubtieren führt. Dass die auf Pinguine fokussierten Pumas einander tolerieren, liegt demnach daran, dass ihre Beute in Hülle und Fülle vorhanden ist: Die Kolonie im Nationalpark zählt inzwischen 40.000 Brutpaare. Die Pumas müssen also nicht um Beute konkurrieren und benötigen kein ausgedehntes Revier, um genügend Nahrung für sich und ihren Nachwuchs zu finden.
"Unsere Arbeit ergänzt eine schnell wachsende Zahl von Veröffentlichungen, die darauf hindeuten, dass die Wiederansiedlung großer Raubtiere in neuen Ökosystemen zu neuen Interaktionen führen kann, die ihr Verhalten verändern", schreiben die Forschenden. Bei Naturschutzbemühungen zur Wiederherstellung der Tierwelt müsse unbedingt berücksichtigt werden, dass die Arten in Ökosysteme zurückkehren, die sich seit ihrem Aussterben erheblich verändert haben.
Der Pinguinkolonie in Patagonien kann die Rückkehr der Pumas bislang wenig anhaben, die Populationszahlen bleiben stabil. Und auch die Pumas sind dort nicht mehr wegzudenken: Der Nationalpark beherbergt inzwischen die höchste bisher registrierte Dichte an Pumas.