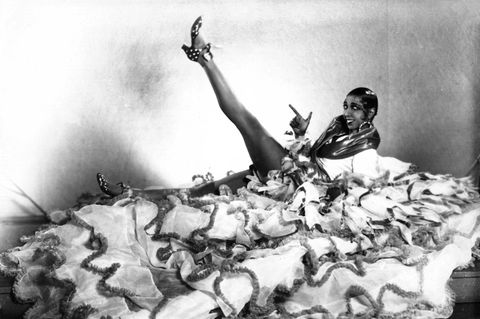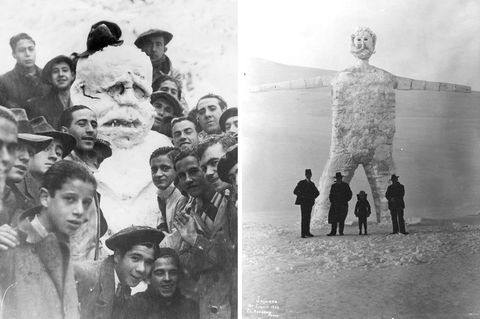Seid fruchtbar und mehret euch – könnten Tiere die Bibel lesen, ihre Natur würde sie nötigen, dieser Weisung auf höchst unterschiedliche Art nachzukommen. Manche scheinen es sich leisten zu können, sich mit der Fortpflanzung über einen langen Zeitraum hinweg zu befassen – die Partnersuche, der Zeugungsakt, das Austragen des Nachwuchses, dessen Geburt und schließlich die Sorge um ihn –, bei vielen Spezies dauert es Jahre, bis die Nachkommen reif sind. Während andere ein paar Dutzend mit Dotter gefüllte Hüllen deponieren, Samen dazu, fertig. Woran das liegt? Eine einfache Antwort gibt es auf diese Frage nicht. Überhaupt ist Fortpflanzung ein Thema, das sich schlichten Regeln entzieht. Alle Säugetiere sind lebendgebärend? Mitnichten: Schnabeltiere und Ameisenigel säugen zwar ihren Nachwuchs, doch er schlüpft aus Eiern. Stets bringt der weibliche Part die Nachkommen zur Welt? Auch das stimmt nicht: Bei den Seepferdchen trägt das Männchen die Jungtiere aus.
Nackt und hilflos starten manche Lebewesen ins Dasein
Dass dem Entstehen neuen Lebens eine Befruchtung vorausgeht, ist nicht einmal zwingend: Über Generationen gebären Blattlaus-Weibchen ihresgleichen, ohne sich je gepaart zu haben. Jungfernzeugung nennen Biologen diese Art der Vermehrung. Auch der Moment des Auf-die-Welt-Kommens hat ungezählte Variationen. Der Nachwuchs zwängt sich durch einen engen Geburtskanal. Er hackt oder schlitzt mit einem Eizahn die umgebende Hülle auf. Er verpuppt sich nach dem Entwicklungsstadium der Larve oder kriecht, kleiner als ein Streichholzkopf, aus der Gebärmutter kommend in einen Beutel, wo er sich an einer Zitze festsaugt. Ein Wesen kann nackt, blind und hilflos ins Dasein starten wie eine Maus. Oder aber schon vom ersten Atemzug an fähig sein zu Flucht und Verteidigung wie eine Klapperschlange. Nichts verläuft einheitlich bei der Fortpflanzung im Tierreich. Zwischen Geburt und Geburt liegen oft Welten – oder zumindest ganze Größenordnungen. Nahezu zwei Jahre sind Elefantenkühe trächtig, länger als alle anderen Säugetiere (bisherige Spitzenleistung einer Spätgebärenden: 760 Tage) – ein Opossum braucht nur zwölf Tage für das Austragen seiner Nachkommen. Weibchen des mit dem Dorsch verwandten Leng legen 20 bis 60 Millionen Eier in einer Laichzeit; das größte je gefundene Ei eines Fisches stammte von einem Walhai, seine Höhe betrug 30 Zentimeter. Ein Weibchen dieser lebendgebärenden Haiart hatte es vorzeitig verloren. Der Nachwuchs einiger Fledermausarten wiegt manchmal fast halb so viel wie das Muttertier – Riesenkängurus „investieren“ nur 0,0003 Prozent des eigenen Körpergewichts in die nächste Generation. Und eine gerade geborene Maus verdoppelt ihr Gewicht in nur fünf Tagen – ein Menschenbaby hingegen erst nach mindestens vier Monaten. Die oft zitierte Vielfalt des Lebens ist also schon in dessen Anfängen verankert. Am ehesten lässt sich System in das Fortpflanzungsgeschehen bringen, wenn man nicht das „Wie“ zum Maßstab nimmt, sondern das: „Wie viele“. Jedem Lebewesen steht nur begrenzt Energie zur Verfügung. Diese kann es nutzen, um zahlreich Nachwuchs zu erzeugen, so wie die Leng-Weibchen – die Kraft reicht dann aber nicht mehr zur Pflege der Brut. Oder die Energie wird aufwendig in Schutz und Fürsorge der Jungtiere investiert, langt dann aber nur für wenige.
Die Zukunft gehört den Mäusen und Kakerlaken
„K-Strategie“ und „r-Strategie“ heißen diese beiden Fortpflanzungstaktiken. Wobei der Begriff Strategie ein wenig in die Irre führt. Denn er legt nahe, das Individuum habe bei seinem Verhalten einen Plan im Kopf, womöglich den Erhalt seiner Art. Dabei spult es nur ein genetisch festgelegtes Programm ab. Doch einmal angenommen, eine Maus oder eine Fruchtfliege, typische r-Strategen, gingen tatsächlich planvoll vor, auf ihrer To-do-Liste stünde: Werde schnell geschlechtsreif, zeuge zahlreiche Nachkommen – und stirb jung. Das Credo eines typischen K-Strategen, eines Elefanten etwa oder Primaten, dagegen lautete: Lass dir Zeit mit dem Fortpflanzen, werde groß und stark, zeuge nur wenige Nachkommen, aber kümmere dich lange und intensiv um sie und werde selber alt. Der r-Stratege setzte darauf, dass hohe Nachwuchszahlen und kurze Generationenfolgen eine hohe Rate (hieraus leitet sich das r ab) an Mutationen bedeuten, also eine Vielzahl zufälliger genetischer Vorschläge, aus denen dann die jeweils tauglichsten selektiert werden. Diese Strategie zahlt sich aus, wenn es darum geht, Nischen schnell zu erobern und sich neuen Bedingungen flugs anzupassen. Der K-Stratege dagegen wettete auf hohe Konkurrenzfähigkeit im harten Konkurrenzkampf um beschränkte Ressourcen. Diese Rechnung geht am besten in einer stabilen Umwelt auf, deren Nischen bereits lange besetzt sind, und wo sich die Populationszahlen an der Grenze der Kapazität (K!) des Lebensraums bewegen. Biologen räumen mit Blick auf eine unter dem Klimawandel sich rasch verändernde Welt den r-Strategen die besseren Zukunftschancen ein. Mäuse, Kakerlaken und „Unkraut“ könnten demnach das Material für die Biodiversität kommender Jahrtausende liefern. Und wir K-Menschen müssten uns Sorgen um unseren Bestand machen.