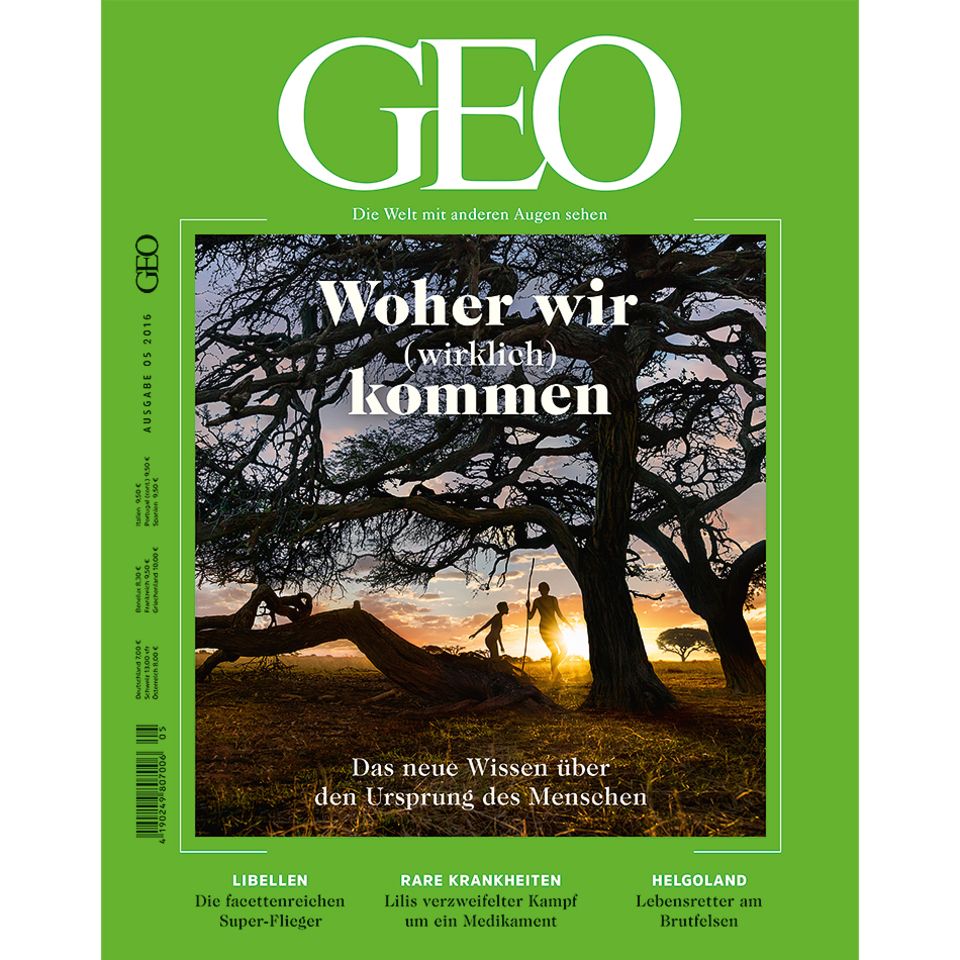Stechmücken, auch Moskitos genannt: blutsaugende, todbringende Kreaturen der Dämmerung, furchtbarer als jene Vampir-Dämonen, die früher in unseren Albträumen nisteten. Mücken erscheinen bei Weitem nicht so glamourös wie Dracula, dafür sind sie, leider, sehr real. Und mit dem plötzlichen Auftreten und der explosiven Ausbreitung des Zika-Virus in Lateinamerika zeigen sich unsere alten Erbfeinde jetzt erneut von ihrer monströsen Seite.
Etwa 3500 Spezies von Stechmücken leben auf der Erde – für eine Insektenfamilie eine bescheidene Zahl. Und unter diesen ist es nur ein kleiner Stoßtrupp von Arten, der die menschliche Gesundheit angreift. Diese Einheit allerdings agiert mobil, schlagkräftig, expansionswütig und perfekt angepasst – die Asiatische Tigermücke gehört dazu, die unter anderem das Denguefieber und das Chikungunyavirus verbreitet, die Malariamücken der Gattung Anopheles oder die Gelbfiebermücke Aedes aegypti.
Die Auswirkungen auf die Gesundheit der Völker sind apokalyptisch. Der Moskitos wegen wird die Menschheit noch immer von Plagen biblischen Ausmaßes heimgesucht: Jahr für Jahr bis zu 500 Millionen Neuinfektionen mit Malaria, dazu 100 Millionen mit Denguefieber. Und als wäre dies nicht genug des Leids, sind Moskitos auch noch für die Neuausbreitung von Seuchen wie dem West-Nil-Fieber verantwortlich. Oder eben für die Zika-Infektion.
Moskitos verursachen einen größeren Verlust an Menschenleben als jedes andere Wesen auf diesem Planeten (uns selbst ausgenommen, selbstverständlich). Was die Frage aufwirft: Wozu eigentlich sind sie gut? Und: Wenn wir sie vom Antlitz der Erde tilgen könnten – sollten wir das tun?
Die Verteidiger der Stechmücke plädieren:
Moskitos sind ein wichtiges Glied in der Nahrungskette. Vor allem in den arktischen Tundren, wo schlüpfende Mücken für wenige Sommerwochen in riesigen Schwärmen auftreten, bieten sie Zugvögeln ein reiches Futterangebot. In einem Beitrag für die Zeitschrift „Nature“ macht Autorin Janet Fang noch auf einen weiteren positiven Effekt aufmerksam: Der Angriff der Moskitoschwärme lenkt die Wanderung der Rentiere um, lässt die Herden vor den Plagegeistern ausweichen – wodurch das Grasland vor Überweidung und Zertrampeln bewahrt wird. Gut. In der Arktis würden die Moskitos also vermisst. Aber sonst? Janet Fangs Umfrage unter Insekten-Ökologen ergab: Die Kollateralschäden einer Ausrottung würden überschaubar bleiben.
Das Überleben nur ganz weniger anderer Tierarten ist direkt an das der Stechmücken geknüpft. Die meisten Mückenfresser würden problemlos auf andere Insekten ausweichen. Fledermäuse etwa bevorzugen sowieso Nachtfalter. Bis auf eine Art: Vespadelus vulternus, eine australische Spezies – sie lebt tatsächlich in enger Abhängigkeit von einer bestimmten Moskitoart.
Aber das ist dann wohl auch schon der beste Fall, den die Mückenverteidiger ins Feld führen können. Und die Mückenlarven? Ja, zugegeben: Die sind in manchen Nahrungsketten des Süßwassers ein wichtiges Glied. Spezialisten wie etwa der Koboldkärpfling („Moskitofisch“) leben von ihnen. Und in den Kleinstgewässern, die sich in den Vertiefungen lebender Pflanzen unter dem Blätterdach des tropischen Regenwaldes bilden, spielen die Moskitolarven ebenfalls eine wichtige Rolle; zum Beispiel für das Überleben bestimmter Pfeilgiftfrösche.
Die Moskito-Anwälte haben zudem eine zweite Verteidigungslinie errichtet. Sie basiert auf dem Konzept der Ökosystem-Dienstleistung und verweist auf die Rolle der Mücken bei der Bestäubung von Blütenpflanzen (die meisten Mücken ernähren sich von Nektar, nur die Weibchen brauchen eine proteinreiche Blutmahlzeit, um Eier zu produzieren). Und die Larven der Mücken reinigen das Wasser, in dem sie leben, da sie sich von organischen Abfällen ernähren.
Weibchen brauchen eine proteinreiche Blutmahlzeit, um Eier zu produzieren). Und die Larven der Mücken reinigen das Wasser, in dem sie leben, da sie sich von organischen Abfällen ernähren.
Doch diese Argumente stechen nicht. Bei der Bestäubung halten die Mücken keineswegs ein Monopol. Sie spielen nur eine Nebenrolle; eine, die (anders als die der Biene) leicht gestrichen und anders besetzt werden könnte. Und die Larven? Sind als Filtrierer im Wasser ebenfalls nicht unabkömmlich. Beide Nischen blieben nach einem Aussterben der Moskitos nicht lange leer, andere Organismen würden rasch nachrücken, die ökologische Wunde würde schnell heilen.
Das Urteil ist gesprochen. Nur: wie es vollstrecken?
Die Mücke an sich, wir wissen es alle, ist ein zerbrechliches Wesen. Indes: Ein Individuum an die Wand zu klatschen ist das eine; ganze Arten zu vernichten etwas ganz anderes. Eine lang erprobte Strategie: ihre Aufzuchtgebiete zerstören. Im 19. Jahrhundert wurde Europa – ungeplant und quasi nebenbei – malariafrei, weil immer mehr Marschen in Ackerland umgewandelt oder industriell erschlossen wurden.
Heute allerdings gelten uns Feuchtgebiete als Brennpunkte der Artenvielfalt, deren Zerstörung sich von selbst verbietet. Hinzu kommt: Einige der schlimmsten Krankheitsüberträger unter den Stechmücken brauchen gar keine naturnahen Gewässer, sie pflanzen sich auch sehr erfolgreich in den Pfützen und Tümpeln fort, die als Abfallbiotope unseres urbanen Lebens entstehen.
Mit Pestiziden lassen sich lokale Populationen effizient ausräumen. Lange Zeit wurde DDT dafür benutzt, durchaus erfolgreich. Doch es hat sich erwiesen: Der rücksichtslose Einsatz von DDT schädigt nicht nur die Moskitos, sondern auch zahlreiche andere Tierarten – und schließlich uns Menschen selbst, da das Gift sich in unserem Körper anreichert.
So haben sich biologische Bekämpfungsmethoden etabliert. Vor allem der schon erwähnte Koboldkärpfling, der eifrig Mückenlarven vertilgt, wird vielerorts künstlich angesiedelt. Auch Libellenlarven räumen kräftig auf – allerdings nur unter regional eng begrenzten Mückenlarvenpopulationen.
Es bleiben Zweifel
Zudem werden neue Methoden erprobt. Forscher verändern das Erbgut in Gefangenschaft aufgezogener Mückenmännchen so, dass diese Nachkommen zeugen, die nicht überlebensfähig sind. Werden solche Männchen in großer Zahl freigesetzt und paaren sich, dann bricht die gesamte Population zusammen.
All diese Methoden wirken. Aber nur in Grenzen. Seit mindestens 40 Millionen Jahren trainieren Moskitos das Überleben in einer ihnen feindlich gesinnten Umwelt. Sie können furchtbare Verluste in kürzester Zeit wieder wettmachen, wenn nur irgendwo ein paar Populationen ungeschoren davonkommen.
Es gibt, soweit ich sehe, keinen guten Grund, Moskitos gegen Ausrottungspläne zu verteidigen. Ihre Vernichtung würde einen Fluch von der Menschheit nehmen. Aber für diesen Kampf müssten wir weiter aufrüsten, vielleicht mit neuen Waffen aus dem Arsenal der Gentechnik.
Doch es bleiben Zweifel. Würden sich die Erreger nicht andere Überträger suchen, Flöhe oder Milben etwa? Vor allem: Mir persönlich gefällt die Idee, Gott zu spielen und Arten auszurotten, ganz und gar nicht. Es ist eine bittere Ironie, dass wir Menschen viele Spezies in ihrer Existenz bedrohen – nur nicht die, welche uns so sehr plagen.
Michael Jeffries lehrt an der Northumbria-Universität im englischen Newcastle. Er ist Spezialist für die Ökologie von Süßwasserteichen.