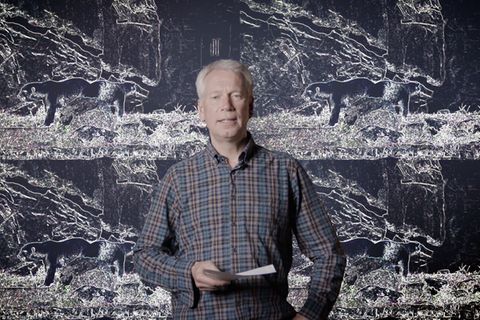Brauchen wir Zoos? Immerhin werden dort wilde Tiere eingesperrt, Tiere, deren Aktionsradius im Extremfall Tausende von Kilometern beträgt. Rainer Maria Rilke hat die ganze Tristesse früherer Einrichtungen in dem beklemmenden Gedicht "Der Panther" eingefangen. Das Tier ist auf allerkleinstem Raum eingesperrt und geistig verkümmert. Aus meiner Kindheit erinnere ich mich an ähnliche Szenen: Manche Tiere liefen hinter den Gitterstäben immer dieselben Schleifen, sodass sich im Beton Mulden im Trittmuster abgewetzt hatten.
Davon sind moderne Zoos Lichtjahre entfernt. So hat etwa der Zoo Hannover mit der "Yukon Bay" eine beeindruckende Illusion der Welt der nördlichen Breiten geschaffen – allerdings aus der Sicht der Besucher.
Die Haltungsbedingungen unterscheiden sich deutlich von denen vergangener Jahrzehnte
Hafengebäude und Schiffe sind für die dort ausgestellten Tiere eher uninteressant, und trotz aller Großzügigkeit ist so eine künstliche arktische Welt winzig: Ein Eisbärenrevier ist in freier Wildbahn leicht mehr als 10 000 Quadratkilometer groß, der gesamte Zoo Hannover dagegen nur 0,22 Quadratkilometer. Natürlich unterscheiden sich die Haltungsbedingungen deutlich von denen vergangener Jahrzehnte, geht es den Tieren viel besser als in den alten Schaugehegen. Zudem schrumpft der Lebensraum der wilden Artgenossen drastisch, nicht nur, aber auch wegen der vielen Urlaubsflüge. Ist es da nicht besser, einige wenige Tiere hier bei uns in einer Illusion von natürlichem Lebensraum erleben zu können, ohne zu weit reisen zu müssen?
Ein zweiter, für mich sehr wichtiger Grund ist Empathie. Ohne Mitgefühl ist Umweltschutz viel schwerer umzusetzen. Wer einmal in die Augen von Schimpansen, Elefanten oder Leoparden geschaut hat, wird sich stärker für den Umweltschutz engagieren als bei der bloßen Lektüre von Klima-Horrormeldungen.
Hinzu kommen Programme zum Artenschutz. Etliche Spezies wie Davidshirsch, Wisent oder Przewalski-Pferd wären ohne Zoonachwuchs und Auswilderungen schon von diesem Planeten verschwunden.
Wenn zu sehr auf Nachwuchs gesetzt wird, kann es durchaus zu Problemen kommen
Was mir weniger gefällt, ist die Darstellung ganzer Tierfamilien ohne die Notwendigkeit der Erhaltungszucht. Wer ständig Nachwuchs zeigen möchte, bekommt Probleme, wenn dieser nicht mehr klein und niedlich ist.
Wohin das führen kann, zeigte der Skandal um den Giraffenbullen Marius. Er lebte 2014 im Zoo von Kopenhagen, stammte aus Inzucht und war deshalb für andere Zoos unbrauchbar. Weil ihn niemand haben wollte, wurde er getötet und an die Löwen desselben Zoos verfüttert. Wenig später wurde dann der Bestand der Löwen gelichtet, indem zwei ältere Tiere mitsamt Nachwuchs eingeschläfert wurden, um Platz für jüngere Tiere zu machen. Gerade wenn Zoos für mehr Empathie sorgen möchten, gerade wenn das ein starkes Argument für Zoos sein kann, finde ich so einen harten Austausch der Statisten mehr als fragwürdig.
Ist dies der Umgang mit in der Natur gefährdeten Tierarten, den wir der nächsten Generation beibringen möchten? Spräche etwas dagegen, wenn der Bestand in solchen Einrichtungen wenigstens zeitweise ohne Nachwuchs wäre und ein wenig überaltern würde?
Das wäre ehrlicher und würde die Gesamtverantwortung besser unterstreichen: Bildung, Erlebnis und Artenschutz. Mit diesem Dreiklang behalten Zoos auch in Zukunft ihre Berechtigung.