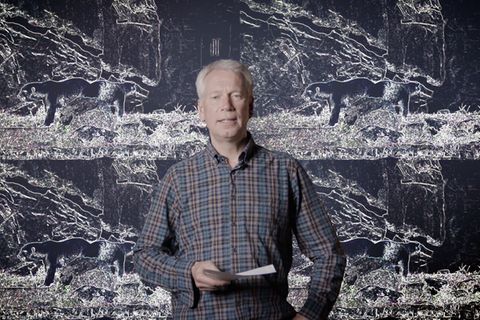Muss man Tiere einer bestimmten Spezies töten, damit die Spezies überlebt? Ja, sagen Zoos. In Nürnberg zum Beispiel hat nun der Direktor zwölf seiner Guinea-Paviane töten lassen. Als Grund führt er den Artenschutz an. Ohne Nachzuchten in Gefangenschaft, so die Argumentation, stürben seltene Spezies aus. Und da in Gefangenschaft natürliche Feinde fehlen, muss eben der Mensch ran. Unbestritten ist: Der Lebensraum der Guinea-Paviane in Westafrika schrumpft, die Art gilt mittlerweile als bedroht. (Lesen Sie hier mehr über die Argumentation der Zoos.)
Doch die Zoo-Logik stoppt nicht das weltweite Artensterben. Und sie steht im Konflikt mit dem deutschen Tierschutzgesetz. Demzufolge braucht, wer ein Tier tötet, einen "vernünftigen Grund". Was "vernünftig" ist, lässt das Gesetz offen. Es ist eine Frage der Abwägung. Wenn das Tier unheilbar krank ist, wenn man ihm absehbare Leiden ersparen will, kann ein Grund zum Töten vorliegen. Doch was, wenn, wie in Nürnberg, das Gehege einfach nur zu klein geworden ist? Weil Auswilderungen gar nicht geplant sind, weil der Zoo es vermasselt hat, die Gruppe zum Beispiel durch Empfängnisverhütung oder Abgabe von einzelnen Tieren, zum Beispiel an geeignete Auffangstationen, klein zu halten? Keine vernünftigen Gründe im Sinne des Gesetzes, argumentieren Juristen.
Die Mitarbeitenden des Nürnberger Zoos haben sich möglicherweise strafbar gemacht, indem sie Tiere im Rahmen des "Populationsmanagements", wie es verharmlosend in der Fachsprache heißt, "entnommen", also getötet haben.
Sie wären nicht die Ersten. Im Jahr 2010 hatte das Oberlandesgericht Naumburg einen Zoodirektor, einen Zootierarzt und zwei Mitarbeiter verurteilt – wegen der Tötung dreier Tigerbabys. Dass die nicht reinrassig waren, wollten die Richter nicht als "vernünftigen Grund" akzeptieren. Die Tötung sei weder erforderlich noch angemessen gewesen. Die Angeklagten hätten entgegen der Rechtsordnung den Arten- über den Tierschutz gestellt.
Von der Not zur Tugend
Aus dieser rechtlichen und moralischen Grauzone versuchen Zoos – in denen europaweit jedes Jahr Tausende gesunde Tiere getötet werden – auszubrechen. Und treten die Flucht nach vorn an, indem sie das Töten von Tieren in ihrer eigenen Obhut zu einer Art Tugend erklären. "Finden wir auch nicht schön, muss aber sein", so die Botschaft an die Öffentlichkeit. Der Kopenhagener Zoo zeigte sich hier als streitbarer Vorreiter, indem er 2014 eine gesunde, aber "überzählige" Giraffe töten und vor Schaulustigen an Löwen verfüttern ließ. Der Protest war kalkuliert – und gewaltig.
In einem Meinungsbeitrag im Wissenschaftsmagazin "PNAS" beklagt unter anderen Dag Encke, der Nürnberger Zoodirektor: "Öffentlicher Druck" und die Rechtsprechung stünden den Tiertötungen entgegen. Dabei sei so etwas für das "langfristige Überleben der Arten unerlässlich". Man solle aber – das ist wohl die Lehre aus Kopenhagen – mit dem Töten bei Tierarten anfangen, die ohnehin als "Beutetierarten" wahrgenommen würden. Sozusagen, um die öffentliche Meinung an das Prinzip zu gewöhnen.
Unerlässlich oder rechtswidrig? Das müssen am Ende Gerichte entscheiden.
Aber es gibt noch eine dritte Perspektive auf das Thema, die in der öffentlichen Debatte über Zootötungen noch viel zu wenig Beachtung findet: In den vergangenen Jahrzehnten hat eine Bewegung Fahrt aufgenommen, die uns nahestehenden Tieren individuelle Persönlichkeitsrechte zuerkennen will. Ein Recht auf Leben, Freiheit, körperliche und geistige Unversehrtheit. Etwas, das für alle Angehörigen der Spezies Homo sapiens selbstverständlich ist oder sein sollte. Die Populationsmanager in den Zoos arbeiten in der umgekehrten Richtung: Sie pochen auf das menschliche Recht, über Leben und Tod von Angehörigen anderer Spezies zu entscheiden. Und folgen damit jenem anthropozentrischen Denken und Handeln, das Arten wie den Guinea-Pavian erst in Bedrängnis gebracht hat.
Aktualisiert am 29.7.2025, 17:20 Uhr