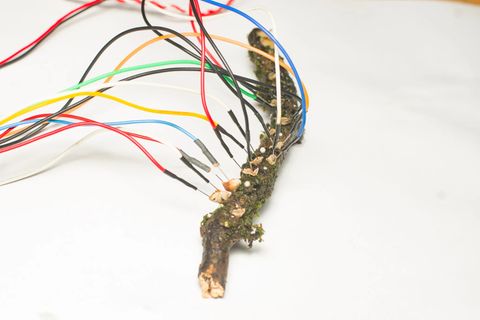In der Natur fallen uns Lebewesen meist dadurch auf, dass sie besonders ästhetisch, farbenprächtig, imposant daherkommen. Oder weil sie zwitschern, bellen, knarren – und damit unsere Blicke auf sich lenken. Einige wenige Arten dagegen erschnüffeln wir, bevor wir sie sehen. Zu diesen Kandidaten gehört zweifellos die Stinkmorchel, die ihrem Namen alle Ehre macht: Rümpfen wir auf einem Waldspaziergang unsere Nase, weil Schwaden von Verwesung durchs Geäst wabern, dann steckt meist dieser erstaunliche Pilz dahinter.
Schon im Frühsommer und bis weit in den Herbst hinein kann man auf den müffelnden Fungus treffen, der in Laub- wie in Nadelwäldern gedeiht, in Parks, Gebüschen oder auch in Gärten. Bevor sie ihren aasartigen Atem in die Umgebung haucht, schlummert die Stinkmorchel in einer kugeligen, von einer Gallertschicht umhüllten Knolle – dem sogenannten Hexenei. Ist die Zeit der Reife gekommen, bricht das Ei auf, und heraus streckt sich – nicht selten innerhalb weniger Stunden – ein bis zu 20 Zentimeter langer, gut vier Zentimeter dicker Stiel.
Auf der kappenförmigen Spitze dieses Fruchtkörpers klebt eine dunkle Masse. Ein Schleim, olivbraun, der voller Pilzsporen steckt und bestialisch stinkt. Eine ganze Reihe flüchtiger Substanzen – darunter einige Schwefelverbindungen – verströmen jenes intensive Fäulnisaroma.
Fliegen fahren auf den Gestank ab und erweisen dem Pilz einen wichtigen Dienst
So abstoßend wir den Geruch empfinden, so verlockend wirkt er auf Aasfliegen. Die hungrigen Insekten glauben, ein gammeliges Stück Fleisch entdeckt zu haben, stürzen sich auf den miefenden Pilz und schlecken die Schmiere, die auch Zucker enthält, auf. Genau so geht die Strategie der Stinkmorchel auf: Sind die Fliegen satt, machen sie sich von dannen und verrichten kurze Zeit später ihre Notdurft. Mit dem dünnflüssigen Kot scheiden sie auch die Sporen aus – und sorgen so für die Verbreitung der nächsten Pilzgeneration.
Ist der dunkle Schleim weggenascht, prangt totenblass der Fruchtkörper: Gestank und Gestalt haben dem Pilz auch den Namen "Leichenfinger" beschert. Die wissenschaftliche Bezeichnung der Stinkmorchel wiederum weist auf ihre Ähnlichkeit mit einem erigierten Glied hin: Phallus impudicus heißt so viel wie "unzüchtiger Penis". In Zeiten der Signaturenlehre (nach dem Prinzip "Ähnliches wird mit Ähnlichem geheilt") galt der obszön anmutende Fruchtkörper mancherorts als Aphrodisiakum. Charles Darwins Tochter indes, so jedenfalls wird berichtet, versuchte, die anstößigen Gebilde weiträumig zu entfernen, da sie fürchtete, der Anblick könne junge Frauen verderben.

Dass die Stinkmorchel uns im Wortsinn an der Nase herumführt, zeigte sich vor einigen Jahren, als ein Waldbesitzer in der Nähe von Dresden für Aufregung sorgte: Ein verdächtiger Geruch sowie der Fund eines Kleidungsstücks animierten den aufgebrachten Herrn, die Polizei zu alarmieren. Doch statt auf eine Leiche stießen die Einsatzkräfte auf den Trickser aus dem Reich der Pilze.
Der Aasgestank entwickelt sich übrigens erst, wenn das Hexenei aufreißt und sich die Stinkmorchel phallisch in die Waldluft reckt. Solange der Pilz im Ei ruht, duftet er sogar angenehm – und ist essbar: Von der Gallertschicht befreit, in Scheiben geschnitten und gut durchgebraten, zählt die Stinkmorchel in diesem Jugendstadium zu den Speisepilzen. Ihr dezentes Aroma erinnert an Rettich und Kohlrabi und steht bei manchen Sammelnden als Delikatesse hoch im Kurs.