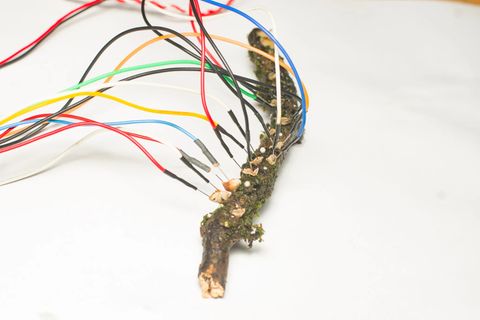Er sieht harmlos aus, man auch könnte sagen: edel. Mit seinem zartgrünen Hut, dem aparten Ring um den Stiel, den weißen Lamellen. Doch Amanita phalloides ist eine trügerische Schönheit. Zumindest wenn er in einem Korb und später in der Pfanne landet. Der Grüne Knollenblätterpilz hält einen düsteren Rekord: Kein anderer Vertreter aus dem Reich der Fungi ist für mehr tödliche Pilzvergiftungen in Mitteleuropa verantwortlich. In Deutschland gehen schätzungsweise neun von zehn Pilzopfern auf sein Konto.
Schon ein einziger Fruchtkörper – rund 50 Gramm – kann genügen, um ein Menschenleben zu beenden. Kein Wunder, dass er im Englischen schlicht "death cap" heißt: Todeskappe.
Besonders tückisch: Der Todeshauch lässt sich weder erschnüffeln noch erschmecken. Der Pilz verströmt ein süßliches Aroma und mundet angenehm. Seine geschmacklosen Giftstoffe aber überstehen Hitze, lassen sich nicht wegkochen. Ein paar Bissen reichen zuweilen, um den Körper in eine fatale Abwärtsspirale zu stürzen. Zunächst wirkt die Mahlzeit noch bekömmlich.
Erst einige Stunden später beginnt das Drama: unstillbares Erbrechen, wässrige Durchfälle, heftige Krämpfe. Symptome, die an eine schwere Lebensmittelvergiftung erinnern – und doch weit gefährlicher sind, weil sie irreführenderweise bald nachlassen. Vergiftete glauben nicht selten, schon auf dem Wege der Besserung zu sein, während in ihrer Leber längst eine stille Vernichtung abläuft.
Eines der Gifte greift in die Eiweißproduktion der Zellen ein
Denn das Alpha-Amanitin, der Hauptakteur unter den "Amatoxinen", blockiert in den Zellen ein Enzym, das eine zentrale Rolle für die Eiweißproduktion spielt. Infolgedessen bricht die Leber, jenes lebenswichtige Chemielabor des Körpers, in ihrer Funktion zusammen. Nach einer kurzen Phase scheinbarer Genesung setzt das Organversagen ein: Gelbsucht, innere Blutungen, schließlich hepatisches Koma. Wer nicht intensivmedizinisch behandelt wird, stirbt innerhalb weniger Tage.
Gerade weil der Grüne Knollenblätterpilz nicht mit greller Tracht vor seinen Giften warnt, lohnt ein genauer Blick auf sein unscheinbares Äußeres. Denn Amanita phalloides lässt sich durchaus erkennen. Man muss nur wissen, worauf es zu achten gilt. Sein Hut spannt sich mit zunehmendem Alter von der halbkugeligen Form zu einem flachen Schirm auf. Er misst bis zu zwölf Zentimeter und zeigt sich in zarten Olivtönen, die zum Rand hin meist verblassen. Unterseits finden sich weiße Lamellen, die nicht mit dem Stiel verwachsen sind, sondern frei ansetzen. Der Stiel selbst ist weiß, brüchig, mit einem filigranen Ring versehen, der oberseits zart gerieft ist.
Am auffälligsten aber ist die namensgebende knollige Basis, die von einer sackartigen Hülle umschlossen wird. Sie steckt oft verborgen im Laub, weshalb unerfahrene Sammlende sie leicht übersehen. Wer Pilze nur abschneidet, riskiert, dieses entscheidende Merkmal nicht zu erkennen. Genau hier liegt die größte Gefahr: die Verwechslung mit beliebten Speisepilzen. Mitunter halten Unkundige den Grünen Knollenblätterpilz für einen Champignon oder einen Täubling. In der Küche ein fataler Irrtum. Darum lautet die goldene Regel der Pilzberatung: Unbekannte Lamellenpilze niemals essen. Immer die gesamte Stielbasis prüfen. Im Zweifel: lieber stehen lassen!
Unter den Wulstlingen finden sich drei weitere tödliche Vertreter
Die Fruchtkörper des Grünen Knollenblätterpilzes gedeihen vor allem zwischen Juli und Oktober, besonders nach Sommerregen, wenn Wärme und Feuchtigkeit zusammentreffen. Und Amanita phalloides ist nicht allein. Mehr als fünfzig Arten aus der Gattung der Wulstlinge (Amanita) recken in Deutschland ihre Hüte in die Waldluft. Vier davon sind potenziell tödlich: neben dem Grünen Knollenblätterpilz etwa der Kegelhütige sowie der Weiße Knollenblätterpilz, deren Gifte ähnlich wirken.
Andere rufen Halluzinationen hervor. Etwa der berühmte Fliegenpilz, in Märchen und Mythen seit Jahrhunderten besungen, dessen diverse Nervengifte berauschen, aber auch Übelkeit, Erbrechen oder Herzrasen hervorrufen können.
Und schließlich finden sich unter den Wulstlingen auch essbare Vertreter, ja, echte Leckerbissen. Etwa der Perlpilz mit seinem zart-milden Aroma. Oder auch der Kaiserling: Amanita caesarea. Der galt schon in der Römerzeit als Delikatesse und wird heute noch in Südeuropa hochgeschätzt. Ein Pilz von geradezu majestätischem Glanz – goldgelber Stiel, orangeroter Hut.
Tödliches Gift oder königliche Speise stehen im Wald nicht selten dicht beieinander. Mehr als 5000 Großpilzarten wachsen in Deutschland – ein Reich von faszinierender, bisweilen verwirrender Vielfalt. Wer sich auf diese Schatzsuche im Wald einlässt, sollte sich schulen lassen, etwa in einem Pilzkurs. Denn nur wer die Eigenheiten kennt, kann das anschließende Festmahl genießen. Ganz ohne Risiko.