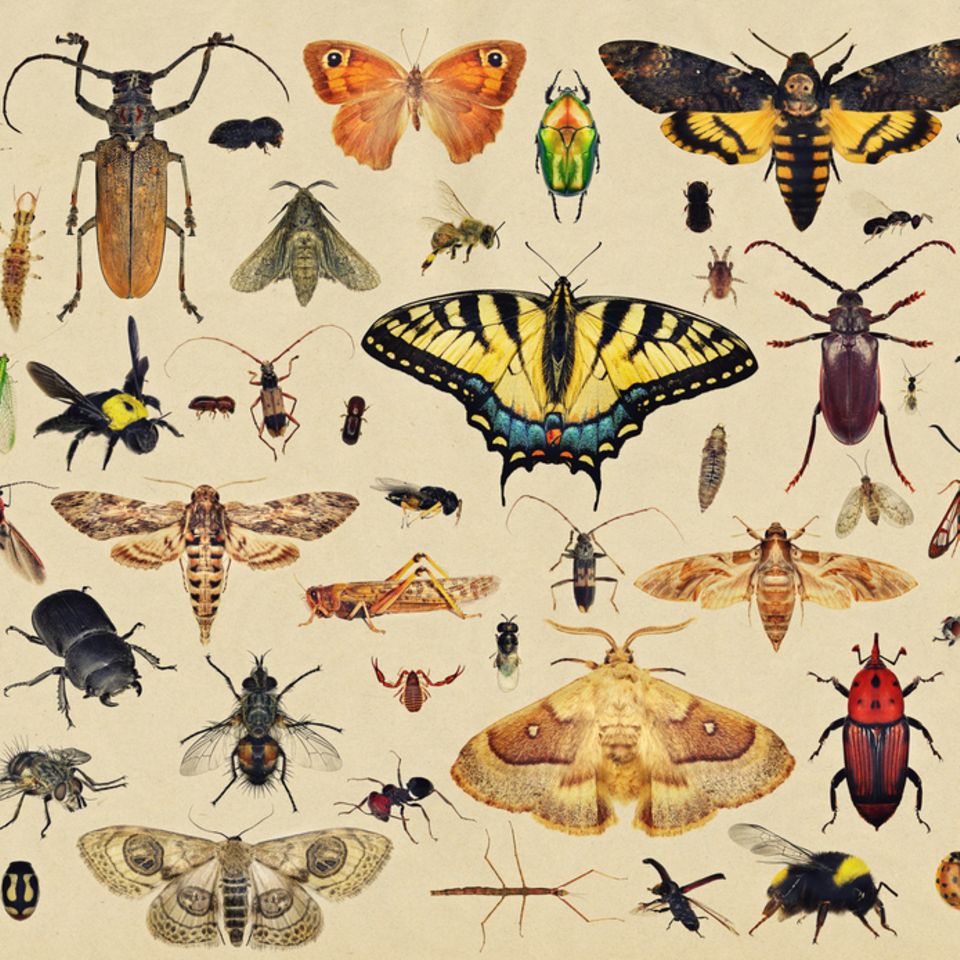Den Schmetterlingen in Deutschland geht es nicht gut. Von 17 untersuchten Tagfalter-Arten hat nur eine einzige zugelegt: der Aurorafalter. Der Falter, der mit dem Kohlweißling verwandt ist, fällt im Frühjahr schon von weitem ins Auge – durch seine orangefarbenen Flügelspitzen.
Nach aktuellen Daten der Naturschutzorganisation Butterfly Conservation Europe und des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung (UFZ), die zwischen 1990 und 2020 erhoben wurden, weisen nur drei der 17 Arten eine stabile Population auf, fünf weitere sind rückläufig. "Der größte Verlierer der letzten Jahre war der Thymian-Ameisenbläuling, der in den Niederlanden zum Beispiel ganz verschwunden ist", sagt Josef Settele, Leiter der Abteilung Naturschutzforschung am UFZ.
Was untersuchten Arten verbindet: Sie sind allesamt Bewohner der Wiesen und Weiden – und damit eines Lebensraums, der nicht nur in Deutschland, sondern europaweit zusehends schwindet. "Seit den ersten Berechnungen im Jahr 1990 hat sich die Situation der Grünland-Falter in Europa deutlich verschlechtert", heißt es in einer Pressemitteilung.
Der Grund für den Rückgang liegt laut UFZ vor allem in der Landwirtschaft. Wiesen und Weiden, besonders im Nordwesten Europas, würden zu intensiv genutzt, Stickstoffhaltige Düngemittel belasten demnach auch noch angrenzende Schutzgebiete. Und verdrängen so für die Falter wichtige Futterpflanzen, die nur auf nährstoffarmen Böden gedeihen. Doch auch eine komplette Aufgabe der Bewirtschaftung ist nicht die Lösung – sondern nur ein weiteres Problem. Denn sie wirkt sich ebenfalls negativ auf die Pflanzenzusammensetzung aus.
Aurorafalter übersteht heiße Sommer als Puppe
Den Aurorafalter scheint das nicht zu kümmern. Und auch die zunehmend trockenen und heißen Sommer können dem Insekt offenbar nichts anhaben. "Der Aurorafalter ist eine der wenigen Arten, die nur im Frühjahr von April bis Juni fliegt und danach die Zeit bis zum nächsten Frühjahr als Puppe überdauert", erklärt UFZ-Forscherin Elisabeth Kühn. "Im Puppenstadium ist er relativ geschützt und die zunehmend heißen und trockenen Sommer kann er besser überstehen." Das sei aber wegen fehlender Daten bislang nur Spekulation.
Die UFZ-Wissenschaftler plädieren dafür, die nachhaltige, insektenfreundliche Bewirtschaftung von Wiesen und Weiden zu fördern, neue artenreiche Lebensräume zu schaffen – und die bestehenden besser miteinander zu vernetzen.
Genau das soll ein geplantes EU-Gesetz leisten, die "Verordnung zur Wiederherstellung der Natur". "Wir hoffen", sagt Chris van Swaay von Butterfly Conservation Europe, "dass die kommende Verordnung zur Wiederherstellung der Natur und damit verbundene Maßnahmen diesen Rückgang stoppen können, damit sich auch unsere Kinder an Schmetterlingen auf blumenreichen Wiesen erfreuen können."
Die ausgewählten 17 Arten sind so genannte Indikatorarten, also Arten, die besonders geeignet sind, Rückschlüsse auf die Lebensbedingungen auch für andere Insekten zu gewinnen. Ihr Vorkommen und ihre Bestandsentwicklung soll zukünftig in allen EU-Staaten untersucht werden, um die Qualität ihrer Lebensräume zu dokumentieren – und Fortschritte bei deren Wiederherstellung.
Insgesamt gibt es in Deutschland rund 140 Tagfalterarten. Belastbare Daten, die Aussagen über Trends ermöglichen, liegen allerdings nur zu der Hälfte von ihnen vor: Immerhin 14 davon weisen einen positiven Trend auf – neben dem Aurorafalter etwa auch der Zitronenfalter, der Kaisermantel und der Kleine Feuerfalter. Eine deutlich größere Anzahl, insgesamt 27 Spezies, ist dagegen rückläufig.