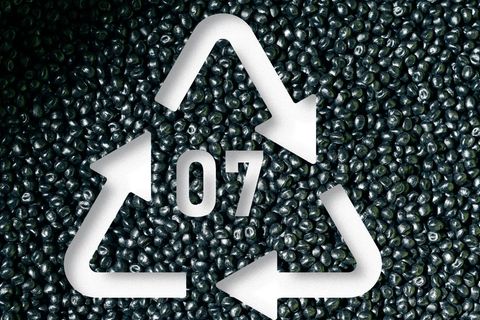Wenn man durch die Diepholzer Moorniederung fährt, fällt einem besonders die Weite der niedersächsischen Landschaft, das satte Grün, gesprenkelt mit den weißen Flocken der Wollgrasblüte, auf. Doch bald werden in dieser wasserreichen Landschaft, zumindest wenn es nach dem Ölkonzern ExxonMobil geht, noch ganz andere Dinge zu bestaunen sein: Bohrtürme, großzügige Zugangsstraßen und Abwasserbecken; in der Diepholzer Moorniederung soll gefrackt werden. Fracking ist ein umstrittenes Verfahren der Bohrtechnik, bei dem durch hydraulischen Druck und mit Hilfe spezieller, teilweise giftiger Chemikalien Risse im Untergrund erzeugt werden, um anschließend Gas zu fördern.
Längst schlagen Wasserversorgungsbetriebe, Mineralbrunnen-Unternehmen und Bürgerinitiativen Alarm. Jüngster Konfliktstoff: die Studie einer Expertenkommission vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, die eine Risikoeinschätzung zum Fracking lieferte. Doch die Neutralität des Gutachtens wird angezweifelt. Denn finanziert und beauftragt wurde die Studie von ExxonMobil selbst. Das Ergebnis der Studie: Die Experten empfehlen eine "langsame Entwicklung in vorsichtigen Schritten", sehen jedoch "keinen sachlichen Grund für ein grundsätzliches Verbot des Frackings".
Neutral oder nicht neutral?
Zu den Zweiflern gehört zum Beispiel Dirk Lütvogt. Als Geschäftsführer der Auburg Quelle wäre sein Unternehmen direkt von den Bohrungen betroffen. Der Mineralbrunnen steht in der Nähe von Diepholz. Rund um die Gegend lagern große Mengen Schiefergas, die ausgebeutet werden sollen. Weil Lütvogt um die Qualität seines Mineralwassers fürchtet, wurde er zu einem der federführenden Mitstreiter im Aktionsbündnis "No Moor Fracking".
Zu der Studie der Expertenkommission des Helmholtz-Zentrums hat er eine ganz eigene Meinung: "Überraschend war schon, dass die Ergebnisse der Studie durchaus schmerzhaft für ExxonMobil sind." Denn die Experten zeigten tatsächlich wesentliche Gefahren auf, die vom Fracking ausgehen. Doch für Lütvogt ist klar: "Diese Ergebnisse waren nötig, damit die Studie halbwegs seriös erscheint."
Die redaktionelle Aufbereitung der Informationen und das Resümee ließen den Auftraggeber dagegen klar erkennen. Die Pressesprecherin von ExxonMobil, Ritva Westendorf-Lahouse, widerspricht: An einem gekauften Gutachten habe ihre Firma kein Interesse, die Experten seien hochrangige, unabhängige Wissenschaftler, die "ihren guten Ruf nicht für uns aufs Spiel setzen würden".

Exxon sucht den Dialog
Um der Kritik zu begegnen und Aufklärungsarbeit zu leisten, startete ExxonMobil einen Informations- und Dialogprozess. Das Unternehmen betont, dass das Fracking-Verfahren bereits seit über 50 Jahren in Deutschland eingesetzt werde. Bisher soll es zu keinerlei Umweltschäden gekommen sein.
Allerdings: Erst jetzt soll Erdgas aus den unkonventionellen Lagerstätten gefördert werden. Bisher fand bei Gas aus diesen Lagerstätten keine kommerzielle Förderung statt. Das Umweltbundesamt bringt in einer Stellungnahme auf den Punkt, was Fracking-Gegner schon lange wütend macht: "Wissenschaftlich fundierte Kenntnisse zu den möglichen Auswirkungen einer Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten liegen für Deutschland zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in ausreichendem Maße vor." Die Risiken für Umwelt und Natur könnten nicht abschließend bewertet werden.

"Nicht mal ans Bohren denken"
Inzwischen hat ExxonMobil sein Vorhaben in die Tat umgesetzt und führt erste Explorationsbohrungen durch. Rein theoretisch beschäftigt sich Axel Preuße von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen mit dem Thema der Flözgasgewinnung. Er leitet ein Forschungsteam, das sich bereits seit 2007 auf der Basis einer wissenschaftlichen Konzession, die die RWTH Aachen hält, mit dem Thema beschäftigt. Eine Bohrung wollen die Wissenschaftler aber erst in Betracht ziehen, wenn alle Eventualitäten ausgeschlossen seien. "Vorher würden wir nicht mal daran denken zu bohren, geschweige denn zu fracken", betont Axel Preuße. Zunächst ging es bei der Forschung hauptsächlich um die technische Machbarkeit. Seit das Verfahren aber zunehmend auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, fokussieren sich die Wissenschaftler auf mögliche Umweltauswirkungen. Als wichtige Aufgabengebiete seiner Forschung sieht Preuße neben der Entwicklung umweltgerechter Methoden zur Stimulation des Erdgases auch die Entsorgung von Frack-Abwässern.
Auch Ulrich Peterwitz, Leiter der Wasserwirtschaft von Gelsenwasser, sorgt sich wegen des Abwasserproblems: "In der Studie, die von ExxonMobil in Auftrag gegeben wurde, bleiben einige Fragen ungeklärt. Zum Beispiel, wie ein sicherer Umgang mit den Frack-Abwässern aussehen soll." Die Gelsenwasser AG ist eines der größten Trinkwasserversorgungs-Unternehmen in Deutschland. Von Anfang an hat sie die Fracking-Vorhaben in Deutschland kritisch begleitet. Zu den drängendsten ungeklärten Fragen gehört für Peterwitz die Entsorgung der toxischen Chemikalien sowie der Frack-Abwässer: Bisher werden die Abwässer, die nach dem Fracken aus dem Bohrloch zurückgepumpt werden, unter anderem in ehemaligen Lagerstätten im Untergrund verpresst. Ob es zu dieser Methode Alternativen gibt, wollen die Forscher nun herausfinden. Und ob es nicht ohne Chemikalien gelingen könnte, die Lagerstätten zu stimulieren. Axel Preuße sieht jedenfalls noch gewaltigen Klärungsbedarf. "Und um solche Forschungen durchzuführen, sind die Universitäten auch auf finanzielle Mittel der Industrie angewiesen, um wissenschaftliche Mitarbeiter bezahlen zu können." Für den Professor ist klar: Ohne die Industrie gäbe es keine praxisnahe Forschung.
Bürgerbewegungen wollen ernst genommen werden
Lieber wäre es Axel Preuße jedoch, mehr öffentliche Mittel für seine Forschung zu bekommen. Damit erst gar keine Abhängigkeiten unterstellt werden können. "Die Nähe zur Industrie generell als verdächtig hinzustellen und den Wissenschaftlern ein persönliches Interesse anzudichten, empfinde ich als Diskreditierung." Und natürlich müssten auch die Bürgerbewegungen mit all ihren Fragen und Sorgen ernst genommen werden. Aber es helfe auch nichts, immer nur gegen technische Neuerungen zu sein. "Irgendwann muss man in der Forschung den nächsten Schritt mal gehen", ist der Wissenschaftler überzeugt. Allerdings sieht auch Axel Preuße deutliche Einschränkungen für den Einsatz des Verfahrens: nicht an geologischen Störungen, nicht in Wasserschutzgebieten und nur, wenn man wirklich weiß, wie es im Untergrund aussieht. Dann sei sogar die Verpressung der Abwässer relativ sicher. Die größere Gefahr sieht Preuße eher über Tage: Wegen des zwangsläufig verstärkten Verkehrsaufkommens von Gefahrguttransporten könnten Lkw-Unfälle zum Problem werden. Oder auch Zwischenfälle auf den Bohrplätzen selbst. Wie auch immer man sich in Deutschland in Zukunft entscheide, sollte man auf keinen Fall sorglos mit der neuen Technik umgehen. "Ein Restrisiko kann man allerdings nirgendwo ausschließen", so der Professor.
Dirk Lütvogt von der Auburg Quelle beunruhigt auch die Frage nach den Spätfolgen. "Durch das Fracking können sich - laut Expertenaussagen - vertikale Risse bis zu 600 Meter Höhe bilden." Das hieße, dass bei einer Bohrtiefe von nur 800 Meter in seiner Gemeinde die Rissbildung bis hinauf in die Grundwasserleiter reichen könnte. Mit Chemikalien angereichertes Methan könnte sich hier den Weg nach oben bahnen und ins Wasser gelangen. "Das ist eine tickende Zeitbombe." Auch stünde das Verhältnis von Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Durch das Freiwerden von Methangas und die aufwändigen Bohrmaßnahmen sei die Klimabilanz beim Fracking vergleichsweise sogar schlechter als bei herkömmlichem Erdgas. Christian Krumkamp von der Bürgerinitiative "Gegen Gasbohren" sorgt sich unterdessen nicht nur um das Grundwasser, sondern auch um die Landschaft, in der er lebt. Durch Infrastrukturen wie Zufahrtswege und Bohrplätze entstehe ein riesiger Flächenverbrauch. "Ich habe Angst, dass von unserer Landschaft nicht viel übrig bleibt."
Neben den vielen offenen Fragen bleiben bisher vor allem Forderungen der Gegner, aber auch der beteiligten Wissenschaftler im Raum stehen. Eine Bedingung der Bürgerinitiativen, die auch vom Umweltbundesamt unterstützt wird, ist die generelle Pflicht für eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Da die Suche nach Gas in Schiefergestein in Deutschland bisher allein dem Bergrecht unterliegt, wird eine UVP erst ab einer gewissen Fördermenge verpflichtend. Die Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten erreicht diese Schwellenwerte in der Regel aber nicht. Das, so sind sich die meisten einig, müsse als erstes geändert werden. Auch deshalb wurde zumindest in NRW die Erdgassuche bis zum Sommer erst einmal gestoppt - bis zum Erscheinen eines Gutachtens, das die nordrhein-westfälische Landesregierung in Auftrag gegeben hat.
Mehr zum Thema auf GEO.de
- Fracking: Das sollten Sie wissen
- Fracking-Boom sorgt für Rechtsruck