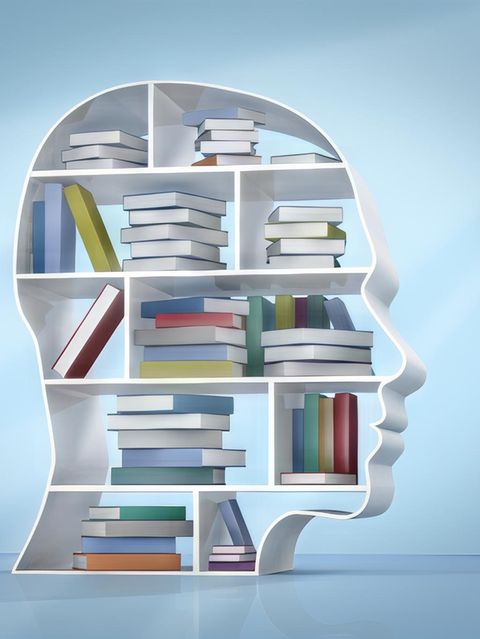18.11.: Deutschland gibt 60 Millionen Euro für Klimawandel-Anpassung
Dürren, Hitzewellen, Überflutungen, Krankheiten – die Erderwärmung macht das Leben für viele schwieriger. Ein internationaler Fonds hilft
Deutschland steuert 60 Millionen Euro zu einem Fonds bei, der besonders betroffenen Ländern bei der Anpassung an den Klimawandel helfen soll. Das verkündete Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém. Bei der Konferenz im Vorjahr im aserbaidschanischen Baku hatte Deutschland ebenfalls eine Zahlung von 60 Millionen Euro bekanntgegeben.
Steigende Temperaturen machen das Leben für viele schwieriger
"Wo Gesellschaften sich nicht an die neuen Klimabedingungen anpassen können, drohen Hunger, Armut und Menschen werden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen", sagte Schneider.
Die steigende Temperatur der Erde macht Ereignisse wie Überflutungen, Dürren, Waldbrände und Stürme wahrscheinlicher. Auch gefährliche Infektionskrankheiten breiten sich nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern mit steigenden Temperaturen aus.
Millionen Menschen mit Fonds unterstützt
Deutschland ist nach Regierungsangaben größter Geber für den sogenannten Anpassungsfonds seit dessen Gründung 2007. Seither habe der Fonds etwa 1,4 Milliarden US-Dollar (etwa 1,2 Milliarden Euro) für rund 200 Projekte in 108 Ländern eingesetzt und damit mehr als 50 Millionen Menschen erreicht.
Mit Spannung wird bei der Weltklimakonferenz eine weitere Ankündigung aus Deutschland erwartet: Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte bei seinem Besuch in Belém eine «namhafte Summe» für den von Brasilien ins Leben gerufenen Regenwaldfonds in Aussicht gestellt.
Länder, die ihre Wälder erhalten, sollen nach dem Modell des Fonds belohnt werden. Umgekehrt sollen sie für jeden zerstörten Hektar Wald Strafe zahlen. Die Regenwälder spielen eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung des Klimas, unter anderem als Speicher von Treibhausgasen.
18.11.: Papst vermisst politischen Willen beim Klimaschutz
In Brasilien geht die Klimakonferenz in die entscheidende Phase. Bislang reicht der Klimaschutz der Staaten längst nicht aus. Nun meldet sich der Papst zu Wort
Papst Leo XIV. kritisiert mangelnden politischen Willen einiger Staaten bei der Bekämpfung der Klimakrise. "Was versagt, ist der politische Wille einiger", sagte er in einer Botschaft zum Auftakt der entscheidenden Woche der Weltklimakonferenz in Brasilien und würdigte die erreichten Fortschritte durch das vor zehn Jahren geschlossene Pariser Klimaabkommen. Nicht das Abkommen habe versagt, sondern "unsere Reaktion darauf". Sein Heimatland, die USA, haben sich unter Präsident Donald Trump aus dem Pariser Abkommen zurückgezogen.
"Die Schöpfung schreit"
Papst Leo machte auf die schon heute spürbaren Klimafolgen aufmerksam: "Die Schöpfung schreit in Form von Überschwemmungen, Dürren, Stürmen und unerbittlicher Hitze. Jeder dritte Mensch lebt aufgrund dieser Klimafolgen in großer Gefährdung."
Mit Blick auf die Klimaverhandlungen der knapp 200 Staaten fordert das Kirchenoberhaupt mehr Ehrgeiz. Noch sei Zeit, den Anstieg der globalen Temperatur unter 1,5 Grad zu halten. "Aber das Zeitfenster schließt sich." Die Menschheit sei als Verwalter der Schöpfung Gottes aufgerufen, mit Weitsicht zu handeln und zu schützen, was Gott ihr anvertraut habe.
17.11.: Amazonas steht unter Stress – mit Folgen für Deutschland
Die grüne Lunge des Planeten schwächelt – und ist derzeit Schauplatz eines Krisengipfels. Ist die Aufmerksamkeit der Welt eine Chance für den Amazonas?
Der Regenwald in Brasilien steht unter Stress – das macht auch dem deutschen Umweltminister Sorgen. "Die Auswirkungen der Regenwälder auf das Weltklima sind auch in Berlin spürbar", sagte Carsten Schneider bei einem Besuch im Amazonasgebiet, in dem aktuell die Weltklimakonferenz stattfindet. "Wenn der Regenwald im Brasilien nicht mehr da wäre oder nur die Hälfte, hätten wir in Deutschland ganz andere Probleme, weil er die Lunge der Erde ist", betonte der SPD-Politiker.
Brasilien will als Gastgeber der Welt die Bedeutung des Amazonas fürs Weltklima vor Augen führen. Die Organisation Greenpeace nutzt die Gelegenheit, um bei Überflügen am Rande zerstörte Gebiete des Regenwaldes von oben zu zeigen. "Der Wald steht leider unter sehr, sehr großem Stress", sagt Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Mehr dazu hier.
17.11.: Zähe Verhandlungen: Baerbock sieht Reformbedarf
Sich mit fast allen Ländern auf die Bekämpfung der Klimakrise einigen? Fast ein Ding der Unmöglichkeit. Annalena Baerbock – diesmal als UN-Vertreterin auf der COP30 – hält Veränderungen für nötig
Ex-Außenministerin Annalena Baerbock sieht bei den oft zähen Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz Veränderungsbedarf. Es sei im Eigeninteresse von Institutionen, sich ständig zu reformieren, sagt die Präsidentin der UN-Generalversammlung beim Besuch der Insel Cambu nahe der Weltklimakonferenz in Brasilien. Es gebe in diesen geopolitisch stürmischen Zeiten Akteure, die Dinge nicht besser machen, sondern kaputt machen wollten. "Und da muss sich dann immer die Mehrheit der Mitgliedstaaten fragen: Wollen wir das? Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen diese Mitgliedstaaten weiter vorangehen."
Bei den Klimaverhandlungen herrscht das Prinzip der Einstimmigkeit, was Beschlüsse schwierig macht. Der langjährige COP-Beobachter Alden Meyer von der Denkfabrik E3G erklärt im "Guardian", mittlerweile gebe es vermehrt Allianzen außerhalb des Prozesses, etwa für Kohleausstieg oder Waldschutz. "Es gibt vermehrt Bestrebungen, "Koalitionen der Willigen" zu bilden, die keine Konsensentscheidungen erfordern. Das ist für die Saudis schwieriger zu blockieren", sagt Meyer mit Blick auf Saudi-Arabien, das in der Vergangenheit schon häufig Fortschritte auf Klimagipfeln blockiert hat.
Ex-Außenministerin Baerbock hat in den vergangenen Jahren die Verhandlungen auf den Klimakonferenzen für Deutschland geführt, nun hat sie eine repräsentative Rolle. Mit Blick auf den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen sagt sie: "Es sind nicht alle vertreten, aber wir hatten diese Zeiten, gerade im Klimabereich, auch schon zuvor." Der schon 30 Jahre andauernde Prozess der Klimakonferenzen sei "ein Wellenprozess gewesen". Es habe etwa 2009 in Kopenhagen ein großes Scheitern gegeben. "Danach gab es das Pariser Klimaankommen. Daran hat auch niemand geglaubt."
Für Baerbock war der Gipfel in Paris auch persönlich ein besonderer Moment: "Ich war damals mit meiner kleinen, sechs Monate alten Tochter auf dieser Klimakonferenz vor zehn Jahren. Und das spiegelt mir immer jetzt zehn Jahre danach so deutlich, dass es in den internationalen Verhandlungen eben auch große Durchbrüche gibt."
Baerbock ist am Rande der Klimakonferenz auf der Kakaofarm der brasilianischen Unternehmerin "Dona Nena" zu Gast, die mit einem hauptsächlich weiblichen Team eine nachhaltige Kakaofarm betreibt und Schokolade herstellt. Die Kakaopflanzen wachsen hier nicht auf einer Plantage, sondern natürlich zwischen anderen Bäumen im Amazonas-Regenwald.
16.11.: Spanien und Frankreich für Abgabe auf Luxus-Flugreisen
Milliardäre im Jet, Bürger zahlen drauf? Warum Spanien und Frankreich jetzt eine Steuer für Luxus-Flüge fordern – und wie das Milliarden für den Klimaschutz einbringen soll
Frankreich und Spanien werben auf der Weltklimakonferenz in Brasilien zusammen mit sieben weiteren Staaten für eine extra Abgabe auf Businessclass-Flugtickets und Reisen mit Privatjets. "Wer mehr verschmutzt, sollte auch mehr beitragen", sagte die spanische Botschafterin in Brasilien, María del Mar Fernández-Palacios, in Belém. "Eine Abgabe auf Premium-Fluggäste kann Milliarden für Klimaresilienz, Anpassung und nachhaltige Entwicklung einbringen." Im Kampf gegen die Klimakrise bräuchten die Staaten berechenbare Einnahmen, die Normalbürger nicht übermäßig belasteten.
Der französische Klimabotschafter Benoît Faraco sagte, Solidaritätssteuern wie die auf Luxusflüge entsprächen dem Geist des Pariser Klimaabkommens zur Eindämmung der Erderwärmung. Man rufe alle Länder auf der Klimakonferenz auf, sich anzuschließen.
Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums von Carsten Schneider (SPD) sagte dem "Spiegel" zu der Idee: "Jeder, der First Class oder im Privatflieger unterwegs ist, wird ohne Probleme darauf eine Abgabe zahlen können."
Allerdings: Erst diese Woche hatte die schwarz-rote Koalition beschlossen, zum 1. Juli 2026 die Ticketsteuer im Luftverkehr zu senken – was ihr scharfe Kritik von Klimaschützern einbrachte.
"Besteuerung von Milliardären und Privatjets notwendig"
Fliegen ist die bei weitem klimaschädlichste Art zu reisen. Nach Angaben der "Premium Flyers Solidarity Coalition" ist nur ein Prozent der Weltbevölkerung verantwortlich für mehr als die Hälfte der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen der kommerziellen Luftfahrt. Gleichzeitig hätten "Premium"-Flugreisen stark zugenommen: Die Emissionen der privaten Luftfahrt seien zwischen 2019 und 2023 um 46 Prozent gestiegen.
Auch die frühere Klimastaatssekretärin von Ex-Außenministerin Annalena Baerbock, Jennifer Morgan, warb für die Solidaritätssteuer im Luftverkehr. "Die Menschen sehen die zunehmende Ungleichheit. Und sie wissen, dass die Besteuerung von Milliardären und Privatjets gerecht und auch notwendig ist."
13.11.: "People's Summit" macht Druck auf den Klimagipfel nebenan
In Brasilien wird deutlich, was auf Klimakonferenzen zuletzt oft fehlte: Das Thema geht alle an. Parallel zu den Verhandlungen machen draußen Hunderte Gruppen Druck
Drinnen verhandeln Diplomaten aus aller Welt, draußen in der Hitze treffen sich Aktivisten und Interessierte zum "Gipfel des Volkes" ("People's Summit"). Parallel zur Weltklimakonferenz treffen sich nach Angaben der Veranstalter in diesen Tagen in Belém mehr als 1.200 Organisationen, Bewegungen und Netzwerke aus Brasilien und dem Ausland.
"Die Klimakonferenz muss diese Wahrheit hören: ohne lebendige Wälder und Menschen, gibt es keine Rettung fürs Klima", sagt die beteiligte brasilianische Aktivistin Alessandra Korap Munduruku.
Dutzende mit Flaggen und Slogans ausgestattete Boote fuhren am Mittwoch (Ortszeit) als Parade an der Küste Beléms entlang – besetzt mit zahlreichen Aktivisten, darunter auch vielen Indigenen. In der Bucht gibt es Veranstaltungen und Informationen rund um die Themen Klima und Umwelt, aber auch viel Musik, Tanz und Kunst – darunter eine Mini-Trump-Statue namens "Die Orangene Plage".
Die große Beteiligung der Zivilgesellschaft in Brasilien ist ein Kontrast zu vorherigen Klimakonferenzen in den vergangenen Jahren: In den autoritär regierten Ländern Aserbaidschan, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten waren außerhalb des Geländes keine Proteste erlaubt.
13.11.: Bericht: Globaler CO2-Ausstoß 2025 weiter gestiegen
Die CO2-Emissionen sind 2025 weiter gestiegen. Auch die Konzentration des Treibhausgases in der Atmosphäre dürfte einen neuen Rekord erreichen, so ein Bericht. Es gibt aber auch ermutigende Signale
Die erhoffte Trendwende beim Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) ist ausgeblieben: Ein Bericht für das Jahr 2025 geht davon aus, dass die weltweiten Emissionen des Treibhausgases weiter steigen, voraussichtlich um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn die Emissionen sich auf diesem Niveau fortsetzen, wird das verbleibende CO2-Budget, das ein Einhalten des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Übereinkommen ermöglichen soll, noch vor 2030 aufgebraucht sein. Eine große internationale Forschungsgruppe um Pierre Friedlingstein von der Universität Exeter stellt ihren Bericht Global Carbon Budget 2025 im Fachjournal "Earth System Science Data" vor.
Demnach steigen die weltweiten CO2-Emissionen in diesem Jahr auf 38,1 Milliarden Tonnen. Im Jahr 2024 waren es 37,8 Milliarden Tonnen. Ein Wachstum gab es bei allen fossilen Brennstoffen: Kohle (+0,8 Prozent), Erdöl (+1,0 Prozent) und Erdgas (+1,3 Prozent). Demnach dürfte der Ausstoß in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent steigen, in Indien um 1,4 Prozent, in China und in der Europäischen Union jeweils um 0,4 Prozent.
"Angesichts der weiter steigenden CO2-Emissionen ist es nicht mehr realistisch, die globale Erwärmung unter 1,5 Grad Celsius zu halten", wird Friedlingstein in einer Mitteilung seiner Universität zitiert. Er und sein Team von etwa 100 Forschungseinrichtungen hatten umfangreiches Datenmaterial zusammengetragen und damit in Computermodellen die globale Entwicklung berechnet.
Der Bericht sieht auch ermutigende Trends
Demnach dürfte die CO2-Konzentration in der Atmosphäre auf 425,7 ppm steigen (parts per million – Teilchen pro Million Teilchen). Im Jahr 2024 hatte sie den Rekordwert von 423,9 ppm erreicht, wie die Weltwetterorganisation (WMO) vor einem Monat mitgeteilt hatte.
Die Forscher sehen jedoch auch positive Trends, die beispielsweise belegen, dass Klimaschutz die Wirtschaft nicht schwächt: "35 Länder konnten ihre Emissionen reduzieren bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum", sagt Co-Autorin Corinne Le Quéré von der britischen University of East Anglia in Norwich mit Blick auf den Zeitraum von 2015 bis 2024. Das seien etwa doppelt so viele Länder wie noch zehn Jahre zuvor.
Zu diesen Ländern gehören demnach zahlreiche europäische Staaten, aber auch Australien, Israel, Neuseeland, Südkorea und Taiwan. Diese Fortschritte seien jedoch nicht groß genug, um angesichts des steigenden Energiebedarfs die globalen Emissionen nachhaltig zu senken, betont Le Quéré.
Die Abholzung von Wäldern hat sich deutlich verringert
Ein weiterer positiver Trend sei, dass sich die Veränderung der Landnutzung, insbesondere die Abholzung von Wäldern, durch umweltpolitische Maßnahmen stark verringert hat, stellt der Bericht fest. "Die Entwaldungsraten im Amazonasgebiet sind zurückgegangen und haben in dieser Saison den niedrigsten Stand seit 2014 erreicht", sagt Julia Pongratz von der Ludwig-Maximilians-Universität München, eine weitere Co-Autorin. Die verheerenden Brände im Jahr 2024 hätten jedoch gezeigt, wie empfindlich das Ökosystem bleibe, wenn die globale Erwärmung nicht begrenzt werde, mahnte Pongratz.
Ein ungünstiger Trend betrifft dagegen die Umweltsysteme, die bisher in großer Menge CO2aus der Atmosphäre aufgenommen haben, die sogenannten Ozean- und Landsenken: Ihre Aufnahmefähigkeit verringert sich, hauptsächlich wegen der Auswirkungen des Klimawandels. Der CO2-Anstieg in der Atmosphäre seit 1960 geht den Berechnungen der Wissenschaftler zufolge zu gut 8 Prozent darauf zurück, dass die Land- und Ozeansenken zunehmend weniger CO2 aufnehmen können. Im Zeitraum 2015 bis 2024 ging die Aufnahmekapazität der Ökosysteme an Land demnach um 25 Prozent zurück, die Aufnahmefähigkeit der Ozeane um 7,9 Prozent.
12.11.: Indigene Aktivisten stürmen Gelände der Klimakonferenz
Etliche Sicherheitskräfte bewachen die UN-Klimakonferenz. Ein gewaltsames Eindringen von Aktivisten haben sie jedoch nicht verhindert. Die Ereignisse werfen unangenehme Fragen auf

Zahlreiche indigene Aktivisten und ihre Unterstützer sind auf das hochgesicherte Gelände der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém eingedrungen. Videos südamerikanischer Medien zeigen, wie sie am Dienstagabend (Ortszeit) gewaltsam eine Tür aufbrachen und sich ein Gerangel mit Sicherheitskräften lieferten.
Auf Instagram-Videos mehrerer Aktivisten war zu sehen, wie eine große Menschentraube von Demonstranten auf den Fluren des Konferenzzentrums Fahnen schwenkte und protestierte. BBC-Reporter beobachteten nach eigenen Angaben, wie UN-Sicherheitspersonal noch anwesenden Delegierten zurief, sie sollten das Gelände verlassen.
Eine lokale Journalistin, die das Geschehen auf dem Gelände verfolgte und aus Sicherheitsgründen anonym bleiben will, sagte einer dpa-Reporterin vor Ort, eine solche Eskalation habe sich schon lange angekündigt. In Brasilien würden immer wieder Umweltschützer getötet, "es gibt diesen Schmerz schon seit langer Zeit". Mit dem Eindringen hätten die Indigenen ein Zeichen setzen wollen.
Indigene auf dem Gipfel auch offiziell vertreten
Auf dem Klimagipfel im Amazonasgebiet sind auch Tausende Vertreter indigener Gemeinschaften vertreten. Sie setzen sich gegen die Zerstörung ihrer angestammten Heimat ein, etwa durch die Abholzung des Regenwalds. Zuvor hatte es einen Marsch durch die Stadt zu den gesundheitlichen Gefahren des Klimawandels mit rund 3.000 Teilnehmenden gegeben.
Deren Organisatoren grenzten sich ausdrücklich von den gewaltsamen Szenen nach Ende ihrer Demo ab. "Die Handlungen, die nach dem Marsch stattfanden, gehören nicht zur Organisation des Ereignisses", erklärte die beteiligte Organisation 350.org. Dem brasilianischen Nachrichtenportal "G1" zufolge sollen zwei Wachleute verletzt worden sein, auf einem Video ist zu sehen, wie ein Wachmann an der Stirn blutet.
Verschärfte Sicherheitslage in Belém
In den sozialen Medien war auf Videos zudem zu sehen, wie Sicherheitskräfte von innen mit Tischen das Gelände verbarrikadierten – das Eindringen konnten sie jedoch nicht verhindern.
Als die Sicherheitskräfte die Lage schließlich wieder im Griff hatten, wurde das Gelände vollständig evakuiert und abgeriegelt. Etliche Reinigungskräfte saßen am Abend draußen vor den Toren. Normalerweise ist die bewachte Zeltstadt, vor deren Zufahrt sogar ein großer Panzer aufgebaut ist, auch über Nacht geöffnet, da sich die Verhandlungen teils in die Länge ziehen und Journalisten aus allen Zeitzonen aus dem Pressezentrum berichten.
Am späten Abend (Ortszeit) hatte sich die Lage wieder beruhigt. Die Zugänge zum COP-Gelände blieben verschlossen, davor bauten sich maskierte Soldaten und andere Sicherheitskräfte auf. Mehrere Polizeiwagen standen mit Blaulicht vor den Toren. Auf dem Gelände selbst liegt die Sicherheitsverantwortung bei der UN-Polizei.
Unangenehme Fragen für den Gastgeber
Für den Gastgeber Brasilien und die Vereinten Nationen stellen sich mit dem Zwischenfall wenige Tage, bevor aus aller Welt Ministerinnen und Minister für die finale Phase der Verhandlungen anreisen, unangenehme Fragen: Wie konnten die Aktivisten eindringen? Weshalb hatten sie überhaupt das Gefühl, sich auf diesem Wege Gehör verschaffen zu müssen? Dies dürfte die Konferenz weiter beschäftigen.
Die Konferenzleitung teilte am späten Abend mit, der Haupteingang werde nach den Ereignissen repariert und ab 7.00 Uhr morgens (Ortszeit, 11.00 Uhr MEZ) am Mittwoch wieder geöffnet.
In Brasilien erstmals wieder Proteste möglich
Erstmals seit Jahren findet die UN-Klimakonferenz wieder in einem demokratischen Rechtsstaat statt, und nicht wie zuletzt in autoritär regierten Ländern wie Aserbaidschan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten. Deren repressive Sicherheitsbehörden hatten Demonstrationen und Kundgebungen von Klimaaktivisten rigoros untersagt und nur auf dem abgeschotteten COP-Gelände selbst geduldet.
Das ist nun in Brasilien anders: Proteste sind auch im Stadtgebiet möglich. Auch zur Halbzeit der Konferenz am Wochenende sind Proteste geplant, flankiert von weiteren "Klimastreiks" rund um den Globus.
11.11.: Einmal durch den Dschungel: Aktivisten-Schiff erreicht COP30
Aus den verschiedensten Ecken Süd- und Mittelamerikas haben sich Dutzende Indigene per Schiff zusammen auf den Weg gemacht. An die Klimakonferenz in Brasilien haben sie eine klare Botschaft
3000 Kilometer per Schiff von den Anden bis in den Amazonas: So sind mehr als 60 indigene Aktivistinnen und Aktivisten zur Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém gereist. "Wir sind in Ecuador gestartet und dann nach Peru, Kolumbien und Brasilien gereist, um die verschiedenen Realitäten der Gebiete in diesem fragilen Ökosystem, dem Amazonas, kennenzulernen und zu verstehen", erzählt der Aktivist Leo Cerda bei der mit bunten Flaggen und kämpferischen Schlachtrufen begleiteten Ankunft der "Amazon Flotilla" am Hafen von Belém.
Gemeinsam mit Vertretern anderer indigener Gemeinschaften will Cerda sich auf der Weltklimakonferenz Gehör verschaffen. Seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter stammen unter anderem aus Ecuador, Peru, Guatemala, Brasilien und Mexiko. Sie tragen bunte Farben, riesige Blumenohrringe, Federn im Haar oder traditionelle Bemalungen auf dem Gesicht.Viele Völker – eine Mission So unterschiedliche ihre Hintergründe sind, haben sie eine gemeinsame Mission, wie die Aktivisten betonen: Klimagerechtigkeit könne es nur geben, wenn die Ausweitung der Ölförderung gestoppt werde und indigene Völker, die den Regenwald schützen, direkt und effektiv finanziell unterstützt würden.
Die derzeitige Klimafinanzierung ist ein Labyrinth, das darauf ausgelegt ist, uns scheitern zu lassen", kritisiert Katty Gualinga aus Ecuador. Während in reichen Industrieländern weiter Subventionen für fossile Brennstoffe flössen, "werden wir aufgefordert, den Planeten ohne Ressourcen zu retten". Amazonas nicht nur elementar für IndigeneAuch Cerda wird deutlich: "Man kann die fossile Industrie in diesem zerbrechlichen Ökosystem nicht ausweiten, denn die Ressourcen stammen aus dem Amazonas und der Amazonas kann nicht länger standhalten." Das Ökosystem sei "sehr wichtig für die Welt – nicht nur für Indigene, sondern für das Weltklima selbst."
10.11.: UN-Gipfel startet mit Kampfansage an Klimaleugner
Donald Trump nennt die Erderwärmung einen Schwindel. Solchen Klimaleugnern stellt sich Brasiliens Staatsoberhaupt zu Beginn der COP30 am Amazonas entschlossen entgegen
Zu Beginn der Weltklimakonferenz in Brasilien hat Präsident Luiz Inácio Lula da Silva den Leugnern der Erderwärmung eine Kampfansage gemacht. Auf dieser "Konferenz der Wahrheit" gehe es auch darum, sich der Desinformation zur Klimakrise entgegenzustellen, sagte der linke Politiker in Belém vor Vertretern aus rund 200 Staaten. "Es ist jetzt an der Zeit, den Leugnern eine neue Niederlage zuzufügen." Unter anderem hatte US-Präsident Donald Trump die Erderwärmung einen "Schwindel" genannt.
Die Gastgeber des zweiwöchigen UN-Gipfels erwarten rund 50.000 Teilnehmer. Die Stadt Belém am Amazonas, eine der ärmsten Brasiliens, ist mit den vielen Besuchern stark überlastet. Dazu sagte Lula, die Konferenz ins Herz des Amazonas zu bringen, sei schwierig, aber notwendig gewesen. "Wer den Wald nur von oben sieht, weiß nicht, was unter seinem Dach geschieht." Nur so könne die Welt der Realität im tropischen Amazonas-Regenwald ins Auge sehen, wo indigene Gemeinschaften durch die Abholzung gigantischer Flächen ihren Lebensraum verlieren.
Wie kann die Krise eingedämmt werden?
Kernfrage des Treffens ist, wie die Erderhitzung eingedämmt werden kann. Die dazu vorgelegten Klimaschutzpläne reichen bei weitem nicht aus, ihre fatalen Folgen abzuwenden. Dies sind etwa häufigere und heftigere Dürren, Stürme, Waldbrände und Überschwemmungen. Zudem geht es auf der COP30 um Forderungen armer Staaten nach hohen Milliardensummen der Industriestaaten, um sich an diese lebensfeindlicheren Bedingungen anzupassen.
UN-Klimachef Simon Stiell strich zur Eröffnung die Erfolge im Kampf gegen die Erderwärmung heraus. Das vor zehn Jahren geschlossene Pariser Klimaabkommen habe den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase gebremst. Doch wolle er nichts schönreden. "Wir müssen viel, viel schneller werden."
Solar- und Windkraft inzwischen am kostengünstigsten
Hoffnung setzt er nach eigenen Worten in die Abkehr von Öl, Gas und Kohle, deren Verbrennung die Klimakrise anheizt. Solar- und Windenergie seien mittlerweile in 90 Prozent der Welt die kostengünstigste Energiequelle. Und erneuerbare Energien hätten die Kohle jetzt als weltweit wichtigste Energiequelle abgelöst. "Jetzt zu zögern macht weder wirtschaftlich noch politisch Sinn – in einer Zeit, in der Megadürren die nationalen Ernten vernichten und die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben."
"Die Wissenschaft wird wirklich nervös"
Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Johan Rockström, äußerte sich beunruhigt. "Die Wissenschaft wird wirklich nervös", sagte er in Belém. "Verliert die Erde ihre Widerstandsfähigkeit? Wird ihre Kühlleistung geschwächt?", fragte er. Selbst wenn alle Klimaschutzpläne aller Staaten umgesetzt werden, sinke der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis 2030 nur um etwa fünf Prozent. Die fünf Prozent müsste aber Jahr für Jahr erreicht werden. "Bis 2030 müssen die Emissionen um 40 bis 45 Prozent gesenkt werden", sagte er.
An die Konferenz appellierte Rockström, ins Handeln zu kommen. "Wir brauchen keine weiteren Verhandlungen über Regeln. Diese COP, und alle zukünftigen, muss liefern."
Deutschland ist in Belém aktuell mit Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan und dem Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth (beide SPD) vertreten. Beide kündigten an, Deutschland werde als verlässlicher Partner für ehrgeizigen Klimaschutz antreten. Allerdings ist die EU mit einem in letzter Minute beschlossenen, abgeschwächten Klimaziel im Gepäck angereist.
Nächste Klimakonferenz in Bonn?
Für Nervosität in der Bundesregierung sorgt, dass die UN-Klimakonferenz nächstes Jahr möglicherweise nach Deutschland kommen könnte. Deutschland will dies angesichts der gigantischen Herausforderungen bei der Organisation möglichst vermeiden. "Um Himmels willen, einigt euch zwischen Australien und der Türkei, damit diese technische Lösung nicht zum Zuge kommt", sagte Klimastaatssekretär Jochen Flasbarth.
Australien und die Türkei wollen beide 2026 die Weltklimakonferenz COP31 austragen. Gelingt keine Einigung, würde die Konferenz mit Zehntausenden Delegierten am Ort des UN-Klimasekretariats stattfinden – und dieses hat seinen Sitz in Bonn.
"Das ist keine Frage des Wollens", betonte in der Klimadiplomatie sehr erfahrene Flasbarth. "Wir müssten es, wir wollen es aber nicht." Man hätte nur zwölf Monate Zeit für die Vorbereitung, brauche aber mehr Zeit. "Deutschland ist ein Land, das aus guten Gründen viele Regeln hat." Die Austragung der Weltklimakonferenz rotiert zwischen den Weltregionen, die Staatengruppen müssen sich intern auf einen Gastgeber einigen.