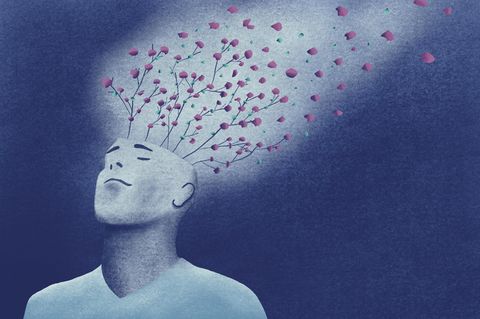Endlich zufrieden sein mit sich und dem Leben: Wer möchte das nicht? Allein: Im Urteil darüber, wie dieser Zustand zu erreichen ist, irren Menschen offenbar erstaunlich oft. So gelten gemeinhin vor allem materieller Wohlstand, Gesundheit oder eine Heirat als Garanten für ein zufriedenes Leben. Etliche Studien zeigen jedoch, dass derartige Ereignisse und Umstände die Art und Weise, wie wir das Leben betrachten und über Erreichtes und Versäumtes befinden, nur in engen Grenzen beeinflussen.
Daher ist es sinnvoll, sich mit den Erkenntnissen von Psychologen, Neurowissenschaftlern und Lebenslaufforschern zu beschäftigen, die inzwischen ein recht präzises Bild davon zeichnen, was Zufriedenheit im Kern ausmacht, worauf sie baut – und wie man sie am besten erreicht. Eine zentrale, vielleicht die wichtigste Botschaft der Experten lautet: Die Grundstimmung, mit der wir durchs Leben gehen, hängt nur in verblüffend geringem Maße von den Wendungen ab, die unser Schicksal nehmen mag. Mehr noch: Grundsätzlich ist jeder Mensch fähig, seine Zufriedenheit zu verbessern.
Der wichtige Unterschied: Warum Glück und Zufriedenheit eng miteinander verwandt sind und doch gänzlich unterschiedlichen Regeln folgen
Es ist eine Sehnsucht, die verständlich erscheint: das unablässige Streben nach Momenten des Glücks. Obendrein sind Glücksgefühle ein starker Antrieb: Euphorie etwa hilft dabei, eine Aufgabe rasch zu erledigen. Ein ganz besonderes unter den Hochgefühlen ist sogar die Voraussetzung für den Fortbestand unserer Art: Sex macht für kurze Zeit glücklich. Im Gehirn kommt es dann zur Ausschüttung von Stoffen, die uns in Ekstase versetzen.
Wenn wir Glück verspüren, erleben wir das stärkste Wohlempfinden, zu dem der Mensch fähig ist. In seiner Wucht kann es sogar Grundbedürfnisse überdecken: Frisch Verliebte etwa vergessen oft das Essen; und wer gerade befördert wurde, absolviert begeistert Überstunden, oft ohne zu merken, dass er an die Grenzen seiner körperlichen Belastbarkeit gerät.
Ein dauerhafter Glückszustand wäre daher durchaus ungesund. Doch ohnehin folgt auf die Euphorie zwangsläufig die Ernüchterung, auch biologisch: Der Körper baut die berauschenden Botenstoffe ab, um Kraft zu tanken für den nächsten emotionalen Ausbruch.
Und so suchen Menschen immer wieder von Neuem nach Glück – ganz gleich, ob es nun um Sex, gutes Essen, einen höheren Verdienst oder darum geht, einfach schneller zu laufen. Doch während uns das Glück oft rauschhaft überkommt (und mitunter ebenso schnell verfliegt), ist die Zufriedenheit ein viel nachhaltigeres Gefühl: Sie setzt gewissermaßen den Grundton, mit dem wir auf unser Leben blicken.
Und sie ist nicht einfach mit dem gleichzusetzen, was Psychologen als "subjektives Wohlbefinden" bezeichnen. Es ist vielmehr ein ganzer Komplex von Empfindungen, der sich aus momentanen Glückserlebnissen ebenso zusammensetzt wie aus dem nachhaltigen Gefühl der Zufriedenheit.
Dieses Wohlbefinden ist selbst auf lange Sicht bei vielen Menschen ziemlich konstant. Zwar unterliegen die momentanen Gefühle oft erheblichen Schwankungen, sie pendeln jedoch um ein bestimmtes Level, das bei den meisten von uns über weite Strecken des Lebens in etwa gleich bleibt.

Einmalige Glückserlebnisse beeinflussen das langfristige Wohlbefinden erstaunlich wenig. So konnte der US-Psychologe Philip Brickman nachweisen, dass Menschen, die in der Lotterie eine große Summe gewonnen hatten, nach einigen Monaten keineswegs positiver über ihre aktuelle Lebenssituation urteilten als jene Personen, die nichts Derartiges erfahren hatten.
Mehr noch: Die Forscher stellten bei den Gewinnern sogar Einbußen an Lebensglück fest. Diesen Menschen gelang es weniger gut, sich an den kleinen Dingen des Alltags zu freuen. Neben dem immensen Geldgewinn und den neuen Annehmlichkeiten, die der ermöglichte, verblassten die schlichten Genüsse.
Diese Anpassung an einen eigentlich als Glück empfundenen Zustand kann einen negativen Prozess in Gang setzen, warnen Psychologen: Die "hedonische Tretmühle" lasse uns immer wieder von Neuem vermeintlichen Glücksbringern hinterherjagen, doch kaum ist ein Traum erfüllt, gewöhnen wir uns schnell an den neuen Zustand, das Hochgefühl verlischt. Und schon muss ein neues Projekt gefunden werden, das uns Erfüllung verspricht.
Wer allein sein Wohlbefinden dauerhaft erhöhen will, ist demnach prinzipiell zum Scheitern verurteilt. Wie aber steht es um die Zufriedenheit? Natürlich speist die sich – zumindest zu einem nicht unerheblichen Teil – auch aus unserem aktuellen Wohlbefinden.
Doch viele Forscher betonen: Wie eng sie mit diesem gekoppelt ist, variiert nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern kann sich auch im Laufe des Lebens verändern. Den Grund sehen die Wissen- schaftler darin, dass die Zufriedenheit zwar ebenso wie das Wohlbefinden eine Emotion ist, in die aber zudem unsere Gedanken und Einstellungen einfließen, unsere Bewertungen aller Erlebnisse, Erfahrungen und Errungenschaften in unserem Leben. Sie bezeichnen die Zufriedenheit deshalb auch als "kognitives Wohlbefinden". Dessen Wandel unterliegt eigenen Gesetzen – und lässt sich viel eher durch bewusstes Denken steuern.
Der Einfluss der Persönlichkeit: Weshalb nichts so sehr über die Zufriedenheit eines Menschen bestimmt wie sein Charakter
Dass das große Gefühl des Glücks kaum geeignet ist, unsere langfristig angelegte Zufriedenheit zu steigern, liegt für Forscher gewissermaßen auf der Hand. Sie wissen: Ein Griesgram wandelt sich nicht zum lebensbejahenden Menschen, nur weil er eine Lohnerhöhung angeboten bekommt, bei einem Preisausschreiben gewinnt oder in die Karibik eingeladen wird. Womöglich empfindet er kurze Ausschläge höchster Genugtuung. Gleichwohl wird er sein Leben im Prinzip eben so mürrisch beurteilen wie zuvor.
Folgt man den Ergebnissen der Forscher, dann lassen sich die Unterschiede in der Lebenszufriedenheit nur zu höchstens 20 Prozent durch Faktoren wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Einkommen, Bildung und Familienstand erklären. Vieles spricht daher dafür, dass Zufriedenheit vor allem eine Frage der Persönlichkeit ist.
Auswertungen von Studien zeigen: Erfüllung beim Blick auf ihr Leben empfinden vor allem jene Menschen, die in Tests hohe Werte für das Charaktermerk mal "Extraversion" erreichen (die also gesellig und aktiv sind und schwierige Situationen eher als Herausforderung denn als Problem sehen). Oder bei denen die Eigenschaft "Gewissenhaftigkeit" ausgeprägt ist (die sich etwa durch strukturiertes Handeln, Prinzipientreue und Disziplin auszeichnen).
Diejenigen dagegen, bei denen das Merkmal "Neurotizismus" stark entwickelt ist (Menschen mit diesem Charakterzug leiden zum Beispiel häufiger als andere unter Ängsten und Stress), sind tendenziell wenig zu frieden mit ihrem Dasein. Weshalb die Faktoren "Extraversion" und "Gewissenhaftigkeit" so vorteilhaft auf die eigene Zufriedenheit einwirken, können Psychologen bislang noch nicht erklären.
Sie vermuten unter anderem, dass die beiden Charakterzüge vor allem eine indirekte Wirkung haben: So knüpfen extravertierte Personen besonders vielfältige und stabile soziale Beziehungen (die wiederum die Zufriedenheit erhöhen). Und besonders gewissenhafte Menschen haben gute Voraussetzungen für die Verwirklichung langfristiger Lebensziele (und so auch für Zufriedenheit).
Andere Forscher betonen, entscheidender sei ein weiterer Aspekt – die Wahrnehmung positiver und negativer Ereignisse: Manche Menschen erleben Gutes besonders intensiv und tendieren dadurch zu einer zufriedeneren Einstellung. Andere reagieren dagegen eher auf negative Erlebnisse und sehen deshalb oft auch ihre ganze Existenz in düsterem Licht.
Unsere Persönlichkeit kann uns also gewissermaßen glauben machen, wir sei en vom Schicksal besonders begünstigt – oder im Gegenteil vom Glück verlassen. Ganz gleich, wie sehr sich der jeweilige Eindruck mit der Wirklichkeit deckt. Dabei spielt die genetische Veranlagung eine gewichtige Rolle. Denn das Erbgut hat erheblichen Anteil an unserer Persönlichkeitsprägung, und die wieder um bestimmt über unser Wohlbefinden.
So stellten US-Forscher fest, dass eineiige, getrennt aufgewachsene Zwillinge als Erwachsene einen ähnlich ausgeprägten Grad an Lebenszufriedenheit aufweisen, obwohl sie teils unter sehr unterschiedlichen Bedingungen lebten. Bei zweieiigen Zwillingen, die gemeinsam in einem Haushalt groß wurden, unterschieden sich Glücksempfinden und Zufriedenheit dagegen deutlich stärker.
Zwei Forschern von der britischen Universität Warwick gelang es sogar, einen genetischen Einfluss auf das Wohlbefinden ganzer Nationen zu identifizieren. Sie verglichen Studien zu Abweichungen im Erbgut zwischen den Bevölkerungen zahlreicher Länder mit Testreihen zu Glück und Zufriedenheit in den entsprechenden Staaten.
Aus diesen Daten errechneten die Wissenschaftler: Je größer die genetische Nähe zur Bevölkerung Dänemarks (das bei internationalen Vergleichen stets einen Spitzenplatz belegt), desto höher ist das subjektive Wohlbefinden der Menschen eines Landes – und zwar unabhängig von geografischen, wirtschaftlichen oder politischen Faktoren.
Diese Veranlagung könne Menschen sogar dann noch prägen, wenn sie selber in einem anderen Land aufwachsen: Auf Basis von Untersuchungen aus den USA, die auch die Abstammung erfassten, stellten die beiden Forscher fest, dass ein deutlicher Zusammenhang besteht zwischen dem Wohlbefinden heutiger Amerikaner und dem der Bewohner ebenjenes Landes, aus dem ihre Vorfahren einst ausgewandert sind.
Wie stark der jeweilige Grad unserer Zufriedenheit bereits in unserem Erbgut angelegt ist, darüber streiten Wissenschaftler noch; einige glauben, unterschiedliche Ausprägungen seien zu 50 Prozent genetisch bedingt, andere gehen so gar von bis zu 80 Prozent aus.