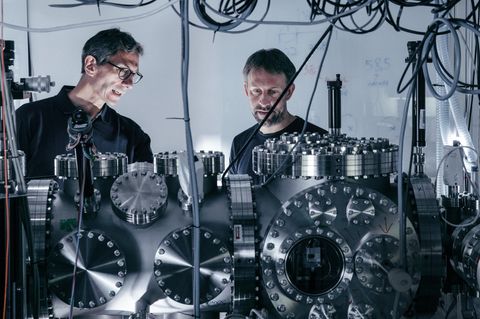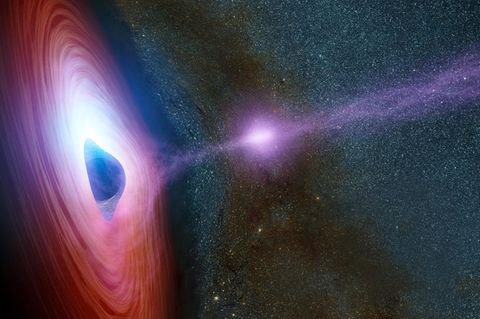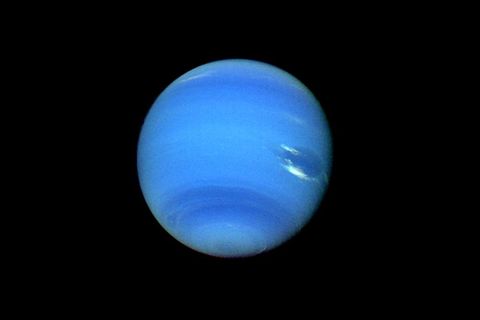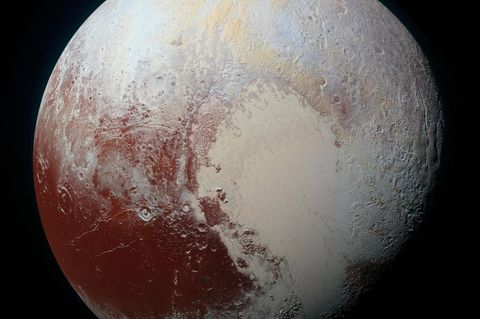GEO: Professor Frank, die längste Zeit Ihrer wissenschaftlichen Karriere haben Sie erforscht, wie Sterne entstehen. Dann, vor einigen Jahren, schwenkten Sie um und suchen seither nach Leben im All. Warum?
Adam Frank: Die Frage, ob es außer auf der Erde noch weiteres Leben im Universum gibt, hat mich schon als Kind fasziniert. Als ich jedoch Mitte der 1980er-Jahre studierte, lag die Forschung dazu brach. Vor allem die Finanzierung fehlte, auch weil es große Vorbehalte gab. Keine schönen Aussichten für einen jungen Astronomen wie mich.
Woher rührten diese Vorbehalte?
Etwa zur selben Zeit, in der die Astronomie ansatzweise über die technischen Möglichkeiten verfügte, der Frage nach Leben im All ernsthaft nachzugehen, kamen die UFOs: unidentifizierte Flugobjekte. Es gab vermeintliche Sichtungen, wie 1947 in Roswell. Vor allem aber entdeckte die Popkultur das Thema und produzierte Filme über Alieninvasionen und fliegende Untertassen. Die wissenschaftliche Suche nach Leben im All wurde von Anfang an mit dieser UFO-Kultur in Verbindung gebracht.
Nicht das seriöseste Umfeld für Forscherinnen und Forscher.
Überhaupt nicht. Das lag vor allem an den nicht vorhandenen Standards, nach denen UFO-Sichtungen für relevant erachtet wurden. In der Szene galt alles als Beweis für eine Sichtung. Und, schlimmer noch, sie interpretierte jedes Ereignis sofort als einen Besuch von Außerirdischen. Es reichte, wenn jemand behauptete, ein Leuchten am Himmel entdeckt zu haben, das sich unnatürlich schnell bewegt habe. Diese furchtbar löchrige Beweisführung zieht sich von den ersten großen vermeintlichen Sichtungen in den 1940er- und 1950er-Jahren bis hin zu den jüngsten Videos der Navy.
Sie spielen auf jene Videos aus den Cockpits von US-Kampfjets an, die mysteriöse Objekte über der Ostküste Nordamerikas zeigen. Die "New York Times" berichtete bereits 2017 darüber, mittlerweile hat das US-Verteidigungsministerium die Videos für die Öffentlichkeit freigegeben.