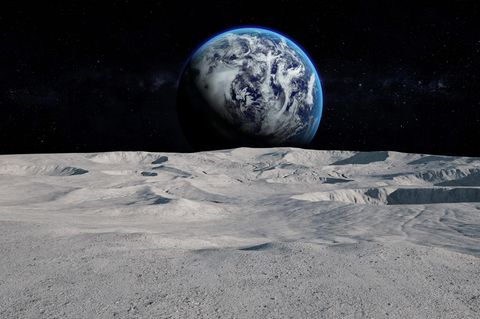GEO: Herr Uhlig, Sie sind Wassersommelier. Das Wort dürfte vielen Menschen nicht unbedingt geläufig sein. Was ist damit gemeint?
Uhlig: Noch vor wenigen Jahren wurde der Begriff "Sommelier" ausschließlich mit der Welt des Weins in Verbindung gebracht. Vom Anbau der Reben bis zur Abfüllung des Weins verfügt ein Sommelier über umfangreiches Wissen. Er ist in der Lage, aus einer Vielzahl von Weinen ein maßgeschneidertes Sortiment zusammenzustellen, um das Weintrinken zu einem Erlebnis zu machen. Im Fahrwasser dieser Tradition bewege ich mich als Wassersommelier. Ich kenne mich unter anderem mit verschiedenen Wasserarten und Quellregionen aus und weiß, womit man welches Wasser gut kombinieren kann.
Welche Arten von Wasser gibt es denn überhaupt?
Das, was wir alle aus dem Hahn zu Hause kennen, ist zunächst Trinkwasser. Hier gilt: Es muss genusstauglich sein, also die Kriterien der Trinkwasserverordnung erfüllen. Diese enthält Schutzvorschriften für reines Wasser. Ähnlich verhält es sich mit Tafelwasser. Dieses muss selbigen Anforderungen entsprechen. Zudem können Mineralstoffe schwankend enthalten sein – je nachdem, wo das Wasser entnommen und durch welchen Reinigungsprozess es aufbereitet wurde.
Anders verhält es sich bei Mineralwasser. Bevor das aus einer Quelle entnommen wird, braucht es eine amtliche Anerkennung und eine separate Genehmigung, um dieses unterirdische Wasservorkommen auch nutzen zu dürfen. Seine einzigartige Zusammensetzung aus Mineralien, Spurenelementen und Temperatur bleibt innerhalb geringer Schwankungen konstant.
Erst wenn es den Anforderungen der Mineral- und Tafelwasserverordnung entspricht, darf es in seiner ursprünglichen Reinheit am Quellort abgefüllt werden.Was vielen Menschen nicht bekannt ist: Es gibt natürliche Heilwasser, die als frei verkäufliche Arzneimittel erhältlich sind und mit einer Pharmazentralnummer (PZN) gekennzeichnet sind.
Was kann man sich unter einem Heilwasser genau vorstellen?
Damit ein Wasser als Heilwasser bezeichnet werden darf, muss der Nachweis erbracht sein, dass es für eine bestimmte Erkrankung vorbeugend, lindernd oder heilend ist. Diese Effekte wurden durch Studien an Probandengruppen festgestellt.
Eine entsprechende Kennzeichnung auf der Flasche gibt Auskunft darüber, für welche Krankheit das Wasser empfohlen wird und welche Trinkmenge förderlich ist. Aber: Die Wirksamkeit eines Heilwassers lässt sich nicht von einem hohen oder niedrigen Gesamtmineralstoffgehalt ableiten, wie oft angenommen wird. Es ist viel komplexer – ein Zusammenspiel von mehreren natürlichen Wassereigenschaften.
Laien fällt es oft schwer, die Qualität von Wasser zu beurteilen. Was kann helfen?
Bei Mineralwasser und Heilwasser empfehle ich, auf die Mineralien zu schauen – also welche drin sind und in welcher Menge. Das kann man auf der Rückseite der Flasche nachlesen, dort stehen alle relevanten Mineralien drauf. Unterteilt wird dabei in eine niedrige, mittlere und eine hohe Mineralisierung. Das zu erkennen ist müßig, ich rate daher eher zu einer Verkostung mit Freunden oder Familie, um zu schauen, was individuell am besten schmeckt oder als am süffigsten empfunden wird.
Wie würde so eine Verkostung ablaufen?
Am besten schickt man eine Person in den Getränkehandel, die sich dort von den Mitarbeitern verschiedene Wasser zusammenstellen lässt – mit ganz unterschiedlicher Mineralisation. Danach lässt man die Leute blind kosten und wird merken: Die Unterschiede lassen sich schmecken.
Für viele Menschen schmeckt Wasser laut eigener Aussage "nach nichts". Das ist also faktisch falsch?
Besonders im Vergleich merken wir schnell: Wasser ist nicht gleich Wasser, es schmeckt unterschiedlich. Wir unterscheiden zwischen vier Geschmacksrichtungen: süß, sauer, bitter und salzig. Die Präferenzen sind hier ganz verschieden. Und auch die Textur des Wassers spielt eine Rolle.
Was ist mit der Textur des Wassers gemeint?
Es gibt Wasser, die den Mundraum zusammenziehen und am Ende ein trockenes Mundgefühl hinterlassen. Das sind Wasser, die sich während ihres Sickerungsprozesses mit nur sehr wenig Mineralien angereichert haben. Sie nehmen viel mit, liefern aber kaum etwas. Dagegen hat ein Wasser mit einem mittleren bis hohen Gehalt an Mineralstoffen und Spurenelementen eine Menge mit dabei.
Jedes Wasser entfaltet durch die Summe seiner Eigenschaften ein ganz eigenes Volumen zwischen Gaumen und Zunge. Eines wird haptisch leicht oder schwer empfunden ein anderes wird bei gleicher Temperatur wärmer oder kühler wahrgenommen. Daraus eröffnet sich ein riesiges sensorisches Feld, das entdeckt werden will.
Welches Wasser schmeckt denn überhaupt wozu gut?
Als Wassersommelier nutze ich dafür den Begriff des "Pairings". Wie bei Komplementärfarben versuche ich, immer ein sensorisches Gegenüber zu haben. Also: Habe ich ein süßes Dessert, trinke ich eher ein säuerliches Wasser. Zu einem kräftigen Kaffee schmeckt ein weiches, liebliches Wasser. Das erzeugt eine schöne Spannung auf der Zunge, wodurch das Kaffeetrinken ein richtiges Erlebnis wird.
Wenn man zum Beispiel einen Wein mit vier verschiedenen Wassern trinkt, kann er auch vier Mal anders schmecken. Das Wasser im Mund kann man sich vorstellen wie eine Vorband bei einem Konzert. Die Vorband schafft es, dass wir aus unserem Alltag gelöst werden und uns auf den Haupt-Act einstimmen können. Mineralwasser bereitet dem Wein oder der Speise die Bühne.
Für Laien ist es ohne Verkostung schwierig, das geschmacklich passende Wasser im Supermarkt auszuwählen. Haben Sie konkrete Empfehlungen?
Wer ein eher süßes, liebliches Wasser sucht, dessen Textur im Mund ein samtiges Gefühl aufbaut, der kann zu "Vilsa naturelle" oder "Rheinsberger Preussenquelle still" greifen. Beide Mineralwasser eignen sich gut zu einem tanninhaltigen Rotwein. Zu einem halbtrockenen Weißwein oder Dessertwein empfehle ich beispielsweise das eher säuerliche "Minawa Medium" oder "Frische Brise Medium". Deren Kohlensäuregehalt putzt den Gaumen und ebnet den Weg für den nächsten Schluck Wein.
Als Heilwasser eignet sich beispielsweise "Staatlich Fachingen Still", das mit seiner still-sanften Quellkohlensäure und seinem hohen Gehalt an Natrium-Hydrogenkarbonat zur Säureregulation beiträgt. Ich nutze es bei Sodbrennen aber auch für den Ausdauersport. Gelegentlich genehmige ich mir vor dem Joggen ein Glas dieses Wassers, um mich zu aktivieren.
Wer nach einem Wasser für Tee sucht, kann "Black Forest still" oder "Bad Brambacher naturell" ausprobieren. Diese Mineralwasser sind niedrig mineralisiert und lösen Stoffe aus dem Tee heraus, die man bisher nicht so deutlich schmecken konnte. Pur getrunken "beobachte" ich nicht nur, wie der Mund, sondern auch die Lippen trocken werden. Ein sanft herbes adstringierendes Mundgefühl bleibt zurück.
Manch einer bevorzugt stilles Wasser, andere eher Wasser mit Kohlensäure. Welches ist aus Expertensicht besser?
Das sollte man individuell angehen. Was spannend ist: Die Sorte "Klassik", bei der viel Kohlensäure zugesetzt ist, wird aktuell weniger gekauft. Es gibt Brunnenbetriebe, die "Klassik" aus dem Sortiment genommen haben. Zwischen "Medium" und "Still“ hat sich ein Wasser mit der Bezeichnung "Sanft“ etabliert. Grundsätzlich reizt die Kohlensäure sanft den Mundraum, vor allem die Zunge. Menschen, die schwer körperlich arbeiten – beispielsweise auf dem Bau oder im Garten – trinken das gern, weil es eine erfrischende Wirkung hat. Wer im Büro arbeitet, sollte Mineralwasser ausprobieren, die mit ihrer Mineralienzusammensetzung für mehr Konzentration sorgen. Endgültig entscheidet aber die persönliche Empfindung.
Wer Geld sparen möchte, greift am liebsten zu Leitungswasser. Handelt es sich dabei um eine gute Alternative?
Letztendlich ist das tatsächlich oft eine Kostenfrage. Leitungswasser muss rein und genusstauglich sein, wird aber auf andere Parameter geprüft als Mineralwasser. Man kann die Unterschiede durch ein Experiment ganz einfach schmecken: Befüllen Sie ein Glas mit Trinkwasser aus dem Hahn und eines mit stillem Mineralwasser.
Lassen Sie beide einen Tag offen stehen. Insbesondere im Sommer werden Sie den Unterschied geschmacklich feststellen. Bei Zimmertemperatur können sich Stoffe potenzieren, die nach unmittelbarer Wasserentnahme nicht zu schmecken sind. Es kann beim Leitungswasser im Abgang eine etwas erdig-laubige Note geben.
Grund dafür sind die sogenannten Huminsäuren, also Fäulnisrestprodukte aus dem Erdreich – von Flüssen, Talsperren und Co. Bei Mineralwasser, das aus dem Tiefengestein entnommen wird, treffen wir auf einen anderen Grad natürlicher Reinheit. Man kann sagen: Bei Leitungswasser variiert jeden Tag das Wassergemisch, bei Mineralwasser bleiben wesentliche Eigenschaften konstant.
Um unerwünschte Stoffe herauszufiltern, greifen viele Menschen zu Trinkwasserfiltern. Halten Sie diese für sinnvoll?
Es gibt viele unterschiedliche Filter, deshalb kann ich keine pauschale Aussage treffen. Für unsere deutschen Verhältnisse erscheint mir ein Aktivkohlefilter aber ausreichend. Wichtig ist nur, dass der Filter nach einem halben Jahr gewechselt wird. Ein Wasserfilter kann wie ein Airbag wirken – falls doch mal etwas Unerwünschtes im Leitungswasser drin sein sollte.