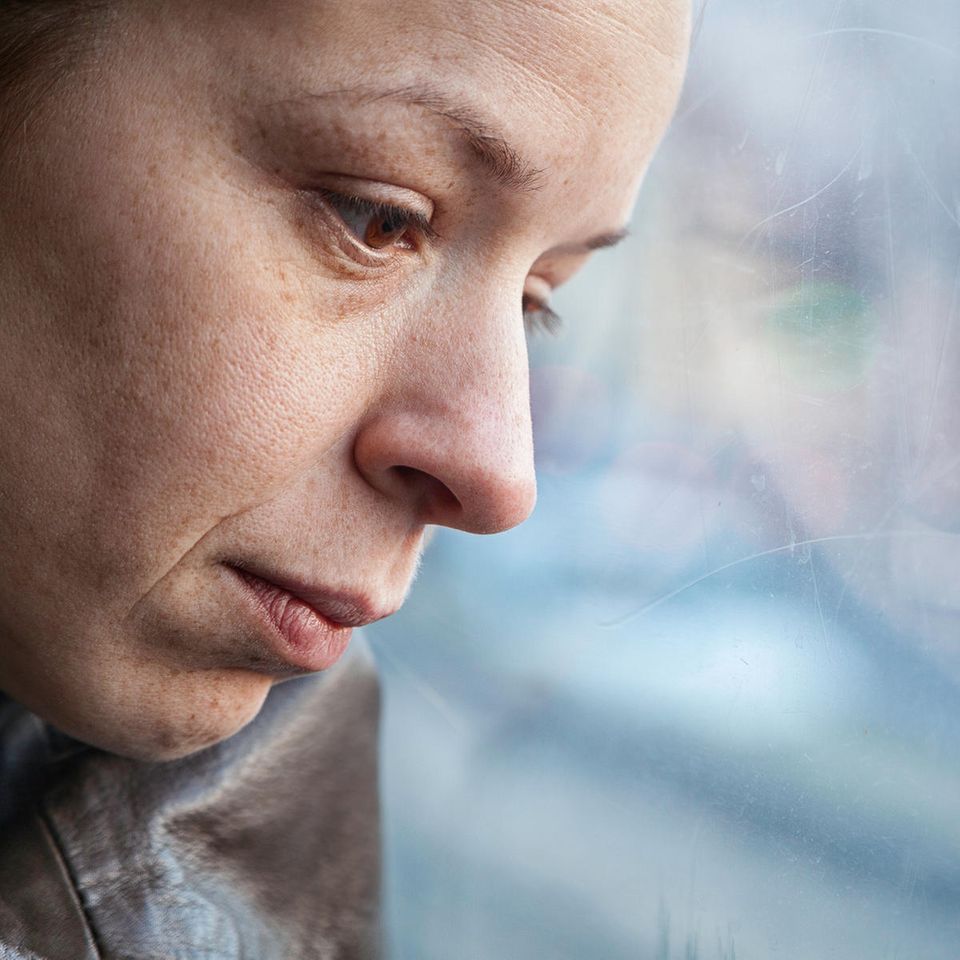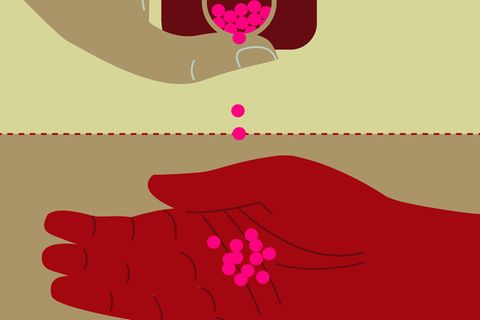Eine Elektroschocktherapie – heute meist als Elektrokonvulsionstherapie (EKT) oder Elektrokrampftherapie bezeichnet – wird in der Regel ausschließlich bei Patientinnen und Patienten mit schwerer oder chronischer Depression eingesetzt. Und auch nur, falls medikamentöse und psychotherapeutische Behandlungen nicht ausreichend wirken. In solchen Fällen hat die EKT anerkanntermaßen eine sehr gute Erfolgsbilanz von bis zu 80 Prozent.
Aber sie hat auch einen sehr schlechten Ruf. Denn die Behandlung wird häufig mit Bildern von krampfenden Menschen in Verbindung gebracht, die schmerzhafte Schocks mit hoher Spannung erhalten. Außerdem haben die Gründe für ihre Wirksamkeit die Psychiatrie und die Neurowissenschaften lange Zeit vor ein Rätsel gestellt. Nun aber konnten Forschende der University of California in San Diego Licht ins Dunkel bringen.
Die "aperiodische Aktivität" wird erhöht
Mithilfe von EEG-Scans untersuchten die Wissenschaftler die Gehirnaktivität von schwer depressiven Patienten, die eine EKT-Therapie erhielten. Und fanden heraus, dass die kontrollierten Stromstöße einer EKT die Depressionssymptome besserten, indem diese die sogenannte aperiodische Aktivität erhöhten. Dabei handelt es sich um eine elektrische Aktivität im Gehirn, die keinem gleichbleibenden Muster folgt und allgemein als "Hintergrundrauschen" angesehen wird.
Eine Funktion der aperiodischen Aktivität im Gehirn ist die Steuerung des Ein- und Ausschaltens der Neuronen. Unsere Hirnzellen durchlaufen ständig Erregungs- und Hemmungszyklen, die den verschiedenen mentalen Zuständen entsprechen. Die aperiodische Aktivität trägt dazu bei, die hemmende Aktivität im Gehirn zu verstärken und sie dann effektiv zu verlangsamen. Die EKT trägt nun nach Erkenntnissen der Forschenden dazu bei, diese Funktion bei Menschen mit Depressionen wiederherzustellen: Die EEG-Scans zeigten demzufolge auch ein sich verlangsamendes Muster der elektrischen Aktivität des Gehirns.
Stigmatisierte Behandlung entmystifizieren
"Wir lösen damit ein Rätsel, das Wissenschaftler und Ärzte seit der Entwicklung der Elektrokonvulsionstherapie vor fast einem Jahrhundert beschäftigt hat”, sagt die Erstautorin Sydney Smith, Doktorandin an der University of California San Diego. "Und wir tragen wir dazu bei, eine der wirksamsten, aber stigmatisierten Therapien für schwere Depressionen zu entmystifizieren."
Das aktuelle Verfahren besteht aus mehreren Behandlungen mit kontrollierten Dosierungen der Stromstöße; es wird unter Narkose durchgeführt. Es gibt allerdings auch Nebenwirkungen wie eine vorübergehende Verwirrung und kognitive Beeinträchtigung.
Die Wirksamkeit von Medikamenten besser einschätzen
"Bei Menschen, bei denen Medikamente nicht wirken, kann die Elektrokonvulsionstherapie jedoch lebensrettend sein, betont Bradley Voytek, Professor für Kognitionswissenschaft an der Universität San Diego. "Wenn wir verstehen, wie sie funktioniert, können wir Wege finden, den Nutzen zu steigern und gleichzeitig die Nebenwirkungen zu minimieren."
Derzeit untersuchen die Forschenden auch die Möglichkeit, die aperiodische Aktivität als Maß für die Wirksamkeit anderer Depressionsbehandlungen zu verwenden, etwa für Medikamente.