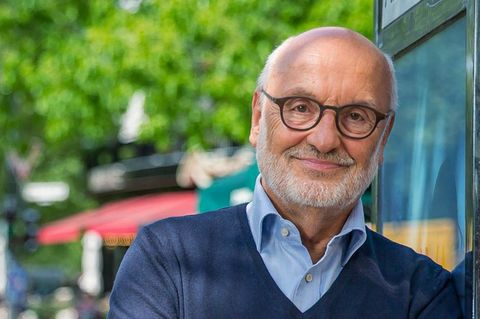Die Bürger der USA haben entschieden: Donald Trump wird für fünf weitere Jahre Präsident von 335 Millionen Menschen und damit eine der mächtigsten Personen der Erde. Seinem Wahlsieg folgen nicht nur die Jubelrufe seiner Fans, sondern auch schockierte Reaktionen aus aller Welt. So heißt es in der australischen Zeitung "The Sydney Morning Herald": "Wenn George Washington der Vater der amerikanischen Demokratie war, dann ist Donald Trump ihr Bestatter", in den Kommentaren eines Instagram-Posts der "New York Times" schreiben Nutzende: "Das Ende ist nah" oder "Willkommen zum Beginn des Faschismus".
Viele befürchten: Mit Trumps erneuter Präsidentschaft beginnt ein dunkles Zeitalter. Doch Fatalismus und Angst machen uns krank und lähmen uns auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Ihre natürlichen Gegenspieler sind Mut, Hoffnung und Zuversicht, die in schwierigen Zeiten zu unserem stärksten Schutzschild werden können. Diese positiven Kräfte wachsen zu lassen, ist das beste Mittel gegen Weltschmerz und vorgestellte Schreckensszenarien – und funktioniert schon mit kleinen Schritten.
Zuversicht stärken: Den Blick öffnen
Optimismus lässt sich nicht erzwingen – und sich von etwas überzeugen zu wollen, das man nicht glaubt, funktioniert ohnehin selten. Es lohnt sich aber, den eigenen Blickwinkel auf die Welt einmal zu ändern und Entwicklungen bewusst aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Statt die Verluste und Gefahren zu betrachten, kann man sich auf das Mögliche und Machbare konzentrieren, zum Beispiel: Wie viel Einfluss hat das auf unser eigenes Leben? Wie kann man sich selbst für demokratische Werte einsetzen?
Das ist ein Kernaspekt der Positiven Psychologie: Sie will das Vertrauen in unser Selbst stärken. Wenn immer mehr Menschen das Gefühl haben, selbst etwas bewegen zu können – etwa durch Engagement in einer sozialen Initiative –, wächst auch in der Gesellschaft insgesamt das Empfinden: Wir können etwas tun, wir müssen uns nicht in Ohnmacht verlieren. Durch dieses Gefühl bekommen wir Hoffnung – und Hoffnung treibt uns an, eine unsichere Zukunft mitzuformen.

Dunkle Gefühle bejahen
Menschen neigen zur Negativität – ein Kniff der Evolution. Denn Angst ist für das Überleben unabdingbar, warnt sie uns doch vor Angriffen und anderen Gefahren. Doch dieser "Negativitäts-Bias" führt dazu, dass wir das Schlechte überhöhen, oft geradezu katastrophisieren. Auch das Gegenteil, nur Positives zulassen zu wollen, bringt uns allerdings nicht voran.
Hilfreich wäre vielmehr, eine Balance zu finden und das Leben in seiner ganzen Bandbreite zu akzeptieren – mit seinen Höhen und Tiefen, seinen Fortschritten und Rückschlägen, mit seinen vermeintlich guten oder schlechten Wahlergebnissen. Dabei sind alle Emotionen wichtig und verdienen ihren Raum. Dunkle Gefühle sollten nicht verdrängt, sondern grundsätzlich anerkannt und akzeptiert werden. Psychologische Studien zeigen: Wenn wir nicht nur von unseren Emotionen mitgerissen werden, sondern uns bewusst mit ihnen auseinandersetzen, gewinnen wir oft eine gewisse Distanz zu ihnen.
Den Lauf der Dinge akzeptieren
Widerstand gegen aktuelle Umstände löst Probleme nicht – im Gegenteil, er kann die Energie rauben, die wir brauchen, um Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Es hilft, das Leben und seine Entwicklungen, anzunehmen – sie mit stoischer Gelassenheit zu akzeptieren.
Über das Leben zu lamentieren ("Jetzt ist alles im Eimer"), über andere ("Wie können die nur so dumm sein?") oder über uns selbst, verstärkt nur das Gefühl, ein Opfer zu sein. Jeder Ausdruck von Unzufriedenheit, ob über kleine oder große Unannehmlichkeiten, kann die innere Stärke zusammenschrumpfen lassen. Stattdessen ist es oft konstruktiver, die Enttäuschung direkt anzuerkennen, zum Beispiel mit dem Gedanken: "Diese Wahl habe ich mir anders vorgestellt!" Damit löst sich zwar die Situation nicht auf – zumindest aber befreien wir uns selbst aus der Opferhaltung und übernehmen Verantwortung für die eigene Einstellung und Gefühlswelt.
Mit Humor verarbeiten
Humor ist eine Ressource, die unsere psychischen Kräfte ungemein stärkt. Vor allem, wenn wir auch mal über uns selbst lachen können, wird Humor zur Geheimwaffe gegen Trübsal. Er nimmt jedem noch so schweren Schicksal für einen kurzen, befreienden Moment seine Schärfe. In Situationen voller Stress oder Ärger verfliegt die Anspannung im Nu. Das liegt auch daran, dass unser Gehirn beim Lachen Glücksbotenstoffe ausschüttet, die als Gegenspieler zu Stresshormonen agieren und sogar Schmerzen lindern.
Darüber hinaus wohnt der Ironie eine ungeheure kreative Wucht inne. Sie vermag festgefahrene negative Gedankenspiralen aufzubrechen. Der Effekt: Wir werden geistig flexibler und sehen auf einmal Lösungen, wo zuvor Hoffnungslosigkeit herrschte. Und wer das Dasein grundsätzlich mit einem Augenzwinkern betrachtet, tut sich leichter, konstruktiv mit problematischen Situationen umzugehen, positiver in die Zukunft zu blicken. Seine größte Wirkung entfaltet das Lachen aber, wenn wir es gemeinsam mit anderen tun. Dann fühlen wir uns auf eine besondere Weise aufgehoben – und mit unserer Verzweiflung weniger allein.
Sich in Hoffnung üben
Angst und Stress machen uns krank – Hoffnung macht uns gesünder. Wie wir sie stärken können, zeigte eine amerikanische Langzeitstudie: Forschende spornten 124 Männer und Frauen an, denen eine große Herzoperation bevorstand, Pläne für das Danach zu schmieden. Keine Weltreisen, keine Wunderheilungen: zu optimistisch – und damit kontraproduktiv –, dann strenge man sich weniger an. Stattdessen: Balkone bepflanzen, einen Italientrip planen oder wandern gehen. Nach einem halbem Jahr kam die Erkenntnis: Zuversichtliche haben eine höhere Chance, gesund älter zu werden. Aktivität, Entzündungs- und Stressmarker waren bei den Hoffenden besser als bei jenen, die nur Medikamente genommen hatten.
Doch wie lässt sich die Hoffnung noch stärken, wenn der Angstfall schon eingetreten ist? Womöglich indem man sich mit Gleichgesinnten zusammenschließt und sich für seine Überzeugungen einsetzt – auch nach der Katastrophe. Indem man sich der Umweltinitiative anschließt, die man schon lange im Blick hatte, oder Begegnungen zur politischen Bildung und Bekämpfung von Rassismus veranstaltet. Nichts verstärkt Hoffnungslosigkeit so sehr wie das Gefühl, mit Sorgen und Ängsten allein zu sein. In Gemeinschaft dagegen hofft es sich leichter – und wirksamer.