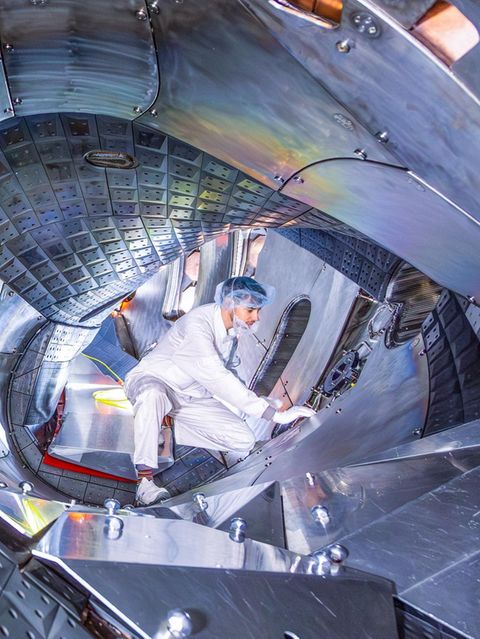Ein Säugling liegt auf dem Rücken, die Augen weit geöffnet. Über ihm flimmert ein Bildschirm, Farben wechseln, Formen springen. Für das kindliche Gehirn ist das kein beiläufiger Reiz, sondern Hochleistungstraining. Neue Daten zeigen nun: Zu viel Bildschirmzeit in den ersten beiden Lebensjahren kann die Reifung des Gehirns beschleunigen, allerdings in eine ungünstige Richtung. Die Folgen werden oft erst Jahre später sichtbar: langsamere Entscheidungen, mehr Angst im Jugendalter.
Ein sensibles Zeitfenster
Dass frühe Kindheit ein empfindlicher Abschnitt der Hirnentwicklung ist, gilt in der Neurowissenschaft als gesichert. Doch wie nachhaltig äußere Reize in dieser Phase wirken, ließ sich bislang nur schwer nachweisen. Genau hier setzt eine Langzeitstudie an, die Forschende der Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) gemeinsam mit der National University of Singapore durchgeführt haben.
Für ihre Arbeit nutzte das Team Daten der großen Geburtskohorte GUSTO ("Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes"). Über mehr als ein Jahrzehnt begleitete es 168 Kinder – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. Mehrfach wurden deren Gehirne per MRT untersucht, später kamen kognitive Tests und psychologische Fragebögen hinzu. Die Ergebnisse erschienen in der Fachzeitschrift "eBioMedicine".
Schnellreifung mit Nebenwirkungen
Der zentrale Befund: Kinder, die vor ihrem zweiten Geburtstag besonders viel Zeit vor Bildschirmen verbrachten, zeigten eine beschleunigte Reifung bestimmter Hirnnetzwerke. Betroffen waren vor allem Areale, die für visuelle Verarbeitung und kognitive Kontrolle zuständig sind, also für Sehen, Aufmerksamkeit und zielgerichtetes Handeln.
Auf den ersten Blick könnte das wie ein Vorteil wirken. Doch die Forschenden warnen vor diesem Trugschluss. Normalerweise entwickeln sich neuronale Netzwerke langsam und abgestuft. Erst mit der Zeit werden sie spezialisierter und effizienter miteinander verschaltet. Bei hoher früher Bildschirmnutzung geschieht diese Spezialisierung zu früh, bevor stabile, flexible Verbindungen entstanden sind.
Die Folge: ein Gehirn, das zwar schneller "erwachsen" wirkt, aber weniger anpassungsfähig ist. Oder, wie es die Erstautorin Huang Pei formuliert: Die Netzwerke seien "vorschnell festgelegt" und damit langfristig weniger resilient.
Späte Folgen eines frühen Reizes
Die eigentliche Brisanz der Studie zeigt sich Jahre später. Mit achteinhalb Jahren bearbeiteten die Kinder einen standardisierten Entscheidungstest. Jene mit den auffälligen Hirnveränderungen benötigten deutlich mehr Zeit, um sich zu entscheiden. Sie zögerten länger, wogen Optionen langsamer ab.
Mit 13 Jahren schließlich berichteten dieselben Jugendlichen häufiger über Angstsymptome wie Sorgen, innere Unruhe, erhöhte Nervosität. Statistisch ließ sich ein durchgehender Pfad nachzeichnen: frühe Bildschirmzeit → beschleunigte Hirnreifung → langsamere Entscheidungsprozesse → mehr Angst im Jugendalter.

Bemerkenswert ist dabei, was nicht gefunden wurde: Bildschirmzeit im Alter von drei oder vier Jahren zeigte diesen Zusammenhang nicht. Das kritische Zeitfenster liegt offenbar klar in den ersten beiden Lebensjahren.
Warum Bildschirme so stark wirken
Eine mögliche Erklärung liefern die Sinnesreize selbst. Bildschirme bieten schnelle Schnitte, starke Kontraste, permanente Bewegung – eine intensive Stimulation, die das unreife Gehirn besonders fordert. Was Erwachsenen oft kaum auffällt, ist für Säuglinge ein dominanter Input, der andere Erfahrungen verdrängen kann: freies Spiel, körperliche Bewegung, soziale Rückkopplung. Gerade diese Wechselwirkungen – Blickkontakt, Sprache, Reaktion – gelten jedoch als entscheidend für eine ausgewogene Vernetzung des Gehirns.
Einen Hoffnungsschimmer liefert eine begleitende Studie derselben Arbeitsgruppe, veröffentlicht 2024 in "Psychological Medicine". Sie zeigt: Wenn Eltern ihren Kindern häufig vorlesen, lassen sich einige der negativen Effekte früher Bildschirmzeit abschwächen.
Gemeinsames Lesen ist alles andere als passiver Konsum. Es verbindet Sprache, Emotion, Aufmerksamkeit und Beziehung. Kinder hören nicht nur Worte, sie erleben Pausen, Betonung, Nähe. Genau diese dialogischen Erfahrungen scheinen jenen Hirnnetzwerken zugutezukommen, die durch frühe Bildschirmreize aus dem Gleichgewicht geraten.
Kein Verbot, aber ein klarer Hinweis
Die Forschenden betonen: Es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Orientierung. In kaum einer Lebensphase ist die Umwelt so prägend – und zugleich so stark von Erwachsenen gesteuert – wie im Säuglingsalter. Was dort geschieht, hinterlässt Spuren, die erst viel später sichtbar werden.
Die Studie liefert damit eine biologische Erklärung für Empfehlungen, die Kinderärztinnen und Fachgesellschaften seit Längerem aussprechen: Bildschirme in den ersten Lebensjahren möglichst zu begrenzen und stattdessen auf das zu setzen, was das Gehirn wirklich braucht. Nähe. Sprache. Zeit.