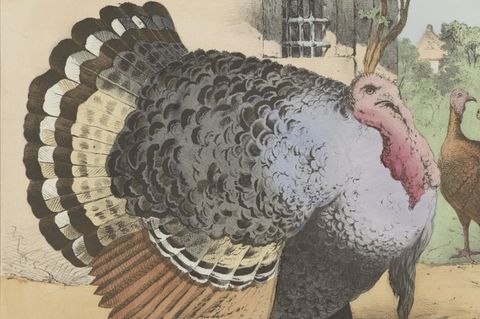Das menschliche Gehirn geht oft sparsame Wege. Es bevorzugt Routinen, arbeitet energieeffizient und ist aus gutem Grund darauf aus, zu schnellen, brauchbaren Schlüssen zu kommen. Nur, wer sich rasch ein Urteil bildet, kann schließlich adäquat reagieren, wenn es brenzlig wird.
In etlichen Alltagssituationen verleitet uns diese Neigung jedoch auch zu irrationalem Verhalten. Denn sie führt dazu, dass wir bei Entscheidungsprozessen die erste Information, die wir erhalten, häufig stärker gewichten als andere. Für das Gehirn bildet dieser erste Eindruck einen maßgeblichen Orientierungspunkt, oder "Anker", von dem aus es weiterdenkt. Das ist ökonomischer als zunächst umfangreich Wissen zu sammeln und dann unabhängig zu urteilen.
Beispiel Hauskauf: Ein Makler setzt den Preis für eine Immobilie auf 500.000 Euro. Auch wenn Käufer das Haus objektiv für weniger wert halten, orientieren sie sich an diesem erstgenannten Preis und bieten häufig nur geringfügig darunter. Beispiel Gehaltsverhandlung: Ein Bewerber nennt zuerst einen Gehaltswunsch von 70.000 Euro. Dieser Betrag beeinflusst die anschließenden Angebote des Arbeitgebers, auch wenn die Marktwerte niedriger liegen sollten. Beispiel Gerichtsurteile: Studien zeigen, dass Juristen höhere Schadensersatzsummen vorschlagen, wenn zuvor ein hoher Betrag in den Raum gestellt wurde, selbst wenn dieser Betrag willkürlich war.
Und als Klassiker das Sonderangebot: Ein ursprünglich teurer Artikel, der mit einem Rabatt angeboten wird, erscheint mit einem Mal hochattraktiv, weil der einstige Preis als Anker dient – selbst wenn der Artikel nie für diesen Betrag verkauft wurde. Anstelle den Wert des Produkts objektiv zu bewerten, nehmen wir das Angebot automatisch als Schnäppchen wahr.
Beliebige Zahlen können zu festen Überzeugungen führen
Auch völlig zusammenhangslose Informationen können unbewusst unsere Einschätzungen färben. In einem Experiment stellten Daniel Kahneman, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, und sein Forschungspartner Amos Tversky Probanden eine Schätzfrage: "Wie hoch ist der Anteil afrikanischer Staaten an den Vereinten Nationen?" Vor der Schätzung mussten die Teilnehmer an einem Glücksrad drehen, auf dem Zahlen zwischen Null und 100 standen. Das Rad war manipuliert und blieb immer entweder bei Zehn oder 65 stehen. Die Ergebnisse waren verblüffend: Teilnehmer, die eine Zehn gedreht hatten, schätzten im Mittel, dass der Anteil bei 25 Prozent läge, während diejenigen mit einer 65 im Durchschnitt auf 45 Prozent tippten. Die zufällige Zahl des Glücksrads – völlig unbedeutend für die Frage – hatte ihre Vorstellung massiv manipuliert.
So machtvoll wirken Anker, dass wir sie oft sogar dann als gegeben hinnehmen, wenn wir wissen, dass sie irrelevant oder manipulativ sind. Umso mehr, wenn sie von einer vermeintlich kompetenten oder autoritären Quelle stammen. Dann erfordert es noch mehr mentale Kraft, sich gedanklich von ihnen zu entfernen. Eher suchen wir selektiv nach Informationen, die einen Anker stützen. Wird uns etwa ein Rabatt auf ein TV-Gerät angeboten, fallen uns sofort Argumente ein, warum dieser Preis ein guter Deal ist. Mögliche Alternativen blenden wir tendenziell aus.
Strategien gegen den Ankereffekt
Sich dem Ankereffekt zu erwehren, ist folglich enorm herausfordernd. Um seinen Einfluss zu reduzieren, ist wohl kaum etwas wichtiger, als um seine Existenz zu wissen. Sobald wir erkennen, dass ein erster Wert oder eine Information möglicherweise nicht objektiv ist, können wir aktiv gegensteuern. In Verhandlungen, beim Shopping oder bei Schätzfragen sollte man sich stets fragen: "Warum wurde dieser Wert zuerst genannt? Könnte er bewusst als Manipulation dienen?"
Dann macht es, na klar, immer Sinn, möglichst unabhängige Informationen einzuholen. Wer im Vorfeld Recherchen anstellt, kann sich eine fundierte Grundlage schaffen und ist weniger von vorgegebenen Ankern abhängig. Das ist vor allem in Verhandlungen nützlich, um selbstbewusst mit realistischen Zahlen argumentieren zu können. Wer um die Macht des Effekts weiß, kann ihn natürlich auch zu seinen Gunsten nutzen – und selbst den ersten Anker setzen. Oder bewusst einen "Gegenanker" platzieren, also eine Position, die ihrerseits stark unter- oder übertrieben ist. Das hilft, die Position des Gegenübers zu neutralisieren.
Und nicht zuletzt bestimmt der Faktor Zeit darüber, wie sehr wir uns von ersten Eindrücken mitreißen lassen. Wir können dem Gehirn zwar nicht befehlen, langsamer zu denken. Aber wir können Entscheidungen bewusst verzögern – und so die Kraft der ersten Information abschwächen. So gelingt es auch, Distanz zu einer emotional oft aufgeladenen Situation zu schaffen. Denn je affektgetriebener wir agieren, desto anfälliger sind wir für einen Anker als ultimativen Referenzpunkt.
Über ihn hinauszudenken, ist der Schlüssel für selbstbestimmte Urteile.



![Hirnforschung: "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert](https://image.geo.de/37054408/t/nc/v16/w480/r0.75/-/migraene-cover.jpg)