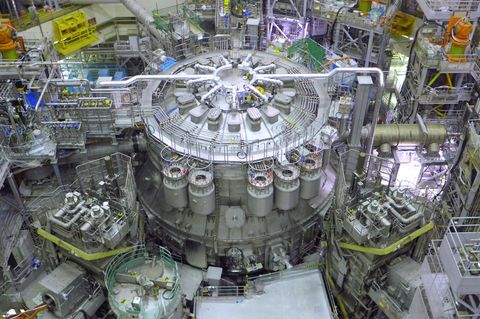Seit vier Monaten ist Deutschlands Ausstieg aus der Atomkraft vollbracht, und doch flammt die Debatte um die Kernkraft immer wieder auf. Anlass ist diesmal der Ausbau der Erneuerbaren: Während die Photovoltaik ihr Ziel übererfüllt, liegt die Windkraft unter Plan.
Nach Einschätzung des Bundesverbands WindEnergie werden in diesem Jahr 2,7 bis 3,2 Gigawatt Windkraft auf dem deutschen Festland neu installiert. Die Ziele der Bundesregierung sehen jedoch 5 Gigawatt vor, ab 2025 sollen sogar jährlich 10 Gigawatt neu hinzukommen. Insgesamt muss sich die Leistung der Windkraft an Land bis 2030 fast verdoppeln, von aktuell 59 Gigawatt auf 115 Gigawatt.
Zwar hat die Regierungskoalition einiges unternommen, um den Bau neuer Windräder anzukurbeln. Beispielsweise liegen diese nun offiziell "im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit". Dadurch erhalten sie bei Einzelfallabwägungen Vorrang, etwa vor dem Denkmalschutz. Doch da die Planungs- und Genehmigungsverfahren laut Branche knapp über zwei Jahre dauern, lässt sich der Zubau kurzfristig kaum steigern.
Kritische Stimmen sagen: Das drohende Scheitern der Windkraft-Ziele zeigt einmal mehr, welch ein Fehler es war, im Frühjahr drei Kernkraftwerke abzuschalten. Mit jeweils rund 1,4 Gigawatt Leistung hatten sie kontinuierlich klimaneutralen Strom geliefert.
Der Ausstieg aus der Kernkraft erhöht den Druck auf die Erneuerbaren. Sie müssen nicht nur die Kohlekraft vom Markt verdrängen, sondern zusätzlich die Kernkraftwerke ersetzen. Oft zitiert wird in diesem Zusammenhang eine Aussage der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, einem Zusammenschluss von Unternehmer*innen innerhalb der CDU und CSU. Sie warben im vergangenen Jahr für längere Laufzeiten der AKWs und schrieben auf ihrer Website: "Möchte man ein Kernkraftwerk durch Windkrafträder ersetzen, würde man pro Kernkraftwerk 1300 bis 3250 Windräder benötigen. Die Tendenz zeigt in der Realität hier jedoch eher nach oben."
Kernkraft und Windkraft: Ist der Vergleich überhaupt zulässig?
Kernkraft und Windkraft direkt gegeneinander aufzurechnen, erinnert an den sprichwörtlichen Vergleich von Äpfeln und Birnen. Falsch wäre es tatsächlich, die installierten Leistungen von Anlagen in Bezug zu setzen, also jene Zahlen, die bislang in diesem Artikel genannt wurden. Sie besagen bloß, wie viel Leistung eine Anlage bei maximaler Auslastung theoretisch liefern könnte. Doch die Auslastung unterscheidet sich je nach Energiequelle gewaltig. Hatten die deutschen AKW eine Auslastung von über 80 Prozent, liegt der Wert bei Windrädern an Land bei 21 Prozent. Deshalb gilt es, nicht die Watt-Zahlen zu vergleichen, sondern die Wattstunden, also die Menge an Strom, die Anlagen tatsächlich liefern.
Doch selbst dieser Vergleich gilt manchen Verfechter*innen der Kernkraft als unzulässig. Ihr Argument: Atomkraftwerke liefern kontinuierlich und damit "sicher" Strom, während Windkraft "unzuverlässig" ist. Allerdings bewerten sie damit die Bedeutung der Atomkraftwerke über. Das Stromnetz läuft nicht dann besonders stabil, wenn stets eine unveränderliche Menge Strom hineinfließt. Stattdessen müssen die Energiebetreiber zu jedem Augenblick exakt so viel Strom einspeisen, wie die angeschlossenen Verbraucher abnehmen. Atomkraftwerke und Windräder haben damit eine Gemeinsamkeit: Sie sind auf eine Technologie angewiesen, die die Lücke zwischen ihrem Angebot und der allgemeinen Nachfrage schließt. Oft geschieht dies durch Gaskraftwerke.
Komplett abwegig ist ein direkter Vergleich von Atomkraft und Windkraft nicht. Doch er hinkt, weil sich beide Energiequellen nicht isoliert betrachten lassen. Sie sind Teil eines größeren, komplexen Ökosystems aus Technologien, die zusammen unser Energiesystem bilden.
Was leistet ein Atomkraftwerk? Und was ein Windrad?
Im Jahr 2022 lieferten die verbliebenen drei Atomkraftwerke 32,7 Millionen Megawattstunden. Entsprechend erzeugte ein einzelnes AKW im Schnitt 10,9 Millionen Megawattstunden Strom.
Schwieriger zu beantworten ist die Frage, was ein Windrad leistet. Im windreichen Norden Deutschlands sind Windräder stärker ausgelastet als im Süden. Außerdem entwickeln sich die Anlagen stetig weiter. Was zurzeit aus den deutschen Landschaften ragt, steht dort oft schon seit zwanzig Jahren. Neu gebaute Windräder sind nicht nur größer und erzeugen dadurch mehr Strom, sie sind auch effektiver und können durch ihre Höhe beständiger Wind abgreifen.
Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion, die für die Atomkraft warb, schrieb ohne Verweis auf eine Quelle, ein Windrad erzeuge im Jahr lediglich 4000 bis 7000 Megawattstunden. Doch diese Zahl ist zu niedrig angesetzt. Moderne Windkraftanlagen bieten oft 6 Megawatt Leistung und können damit 12.000 Megawattstunden Strom produzieren. Stehen sie besonders günstig, bringen sie es sogar auf 15.000 Megawattstunden. Soweit die Angaben in den Katalogen.
Doch da von der Planung bis zum Bau einer Windkraftanlage viel Zeit vergeht, werden nicht immer Windräder neusten Typs errichtet. Jene Anlage, die im ersten Halbjahr 2023 gebaut wurden, hatten durchschnittlich 4,7 Megawatt. Wie viel Strom sie liefern, ist noch nicht bekannt, weil sie erst seit Kurzem im Einsatz sind. Referenzwerte werden üblicherweise über fünf Jahre hinweg erhoben, gemittelt und dann veröffentlicht.
Als Referenz in diesem Artikel dient daher eine Modellierung des Wirtschaftsforschungsunternehmens Prognos, die den Plänen der Bundesregierung zum Ausbau der Windkraft entspricht. Ihr zufolge liefert in der kommenden Dekade 1 Megawatt installierte Leistung rund 2.000 Megawattstunden pro Jahr. Ein in diesem Jahr errichtetes Durchschnitts-Windrad kommt entsprechend auf 9400 Megawattstunden pro Jahr.
Wie viele Windräder ersetzen also ein Atomkraftwerk?
Von dem im Jahr 2023 errichteten Durchschnitts-Windrad sind 1160 Stück nötig, um so viel Strom zu produzieren wie ein Atomkraftwerk. Das entspricht 5,45 Gigawatt installierter Leistung – und damit, grob überschlagen, allen Windkraftanlagen, die 2022 und 2023 an Land gebaut wurden und voraussichtlich noch gebaut werden.
Diese Zahlen liefern aber nur eine Momentaufnahme, da die Windräder Jahr für Jahr besser werden. Würden allein moderne 6-Megawatt-Anlagen errichtet, wären 730 bis 910 Windräder an Land ausreichend, um ein AKW zu ersetzen.
Was bedeutet das Ergebnis in der Realität?
Sechs Atomkraftwerke wurden von 2020 bis 2023 abgeschaltet. Müsste dieser Wegfall allein von Windkraftanlagen an Land kompensiert werden, gingen viele Jahre des Ausbaus nur dafür drauf.
Allerdings existieren auch Windräder auf dem Meer. Moderne Offshore-Turbinen bieten 12 Megawatt und ermöglichen laut Prognos in den dicht bebauten Flächen der deutschen Parks 42.000 Megawattstunden. 260 dieser Anlagen reichen aus, um so viel Strom zu liefern wie ein Atomkraftwerk.
Die Frage "Wie viele Windräder braucht es, um ein Atomkraftwerk zu ersetzen?" ist überspitzt. Sie stellt zwei symbolisch überfrachtete Technologien gegenüber. Doch den Großteil der Transformation stemmen andere Erneuerbare. Während sich die Leistung der Windkraft Onshore bis 2030 verdoppeln soll, soll sich jene der Windkraft Offshore mehr als verdreifachen, die der Photovoltaik sogar vervierfachen. Verteilt man die Last der sechs abgeschalteten AKWs auf alle Erneuerbaren, könnte solch ein Mix die Kernkraft ersetzen: 2500 Windräder an Land (12 Gigawatt), 330 Windräder auf dem Meer (4 Gigawatt) plus 30 Gigawatt Photovoltaik.
Allerdings: Früher oder später hätte Deutschland die Atomkraftwerke ohnehin abschalten müssen. Einen Neubau von AKW hat keine Bundesregierung in Betracht gezogen. Entsprechend ändert die Abschaltung der sechs AKW nichts an der Zahl der Windräder und Solarzellen, die zum Abschluss der Energiewende – geplant für 2045 – in unserer Landschaften stehen müssen. Lediglich der Zeitpunkt, zu dem sie benötigt werden, ist nach vorn gerückt.