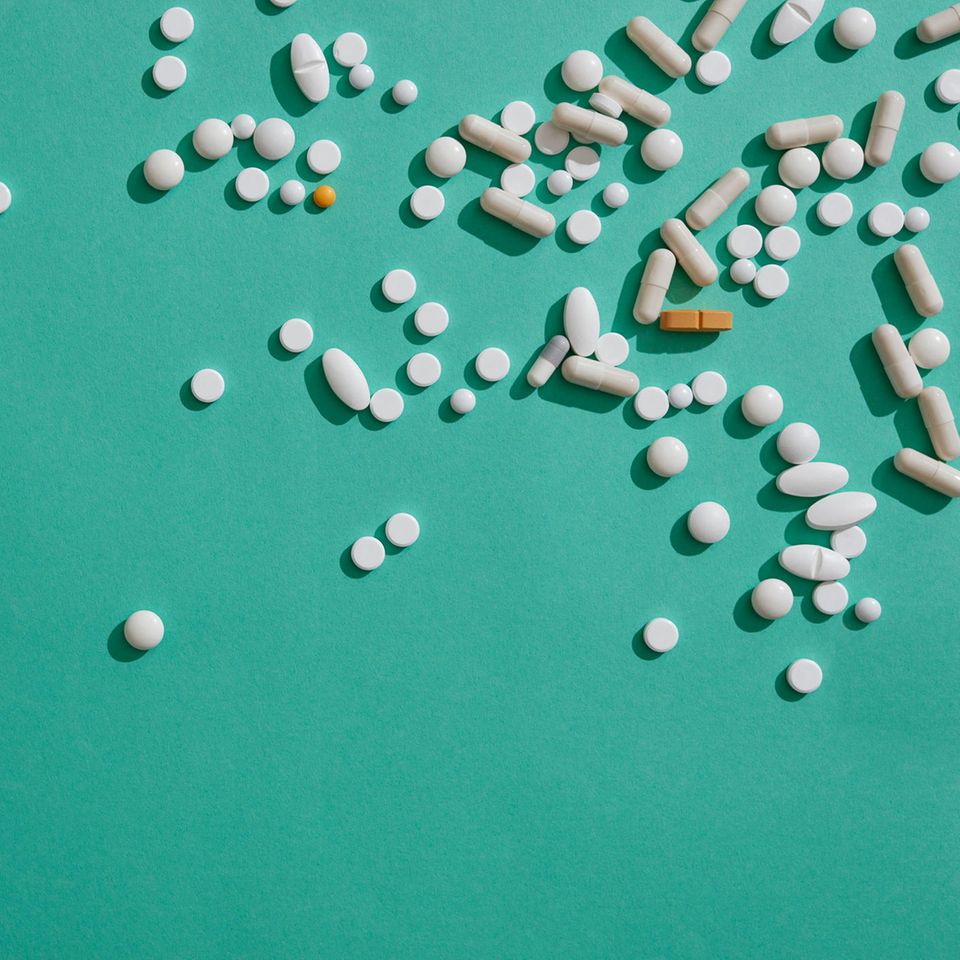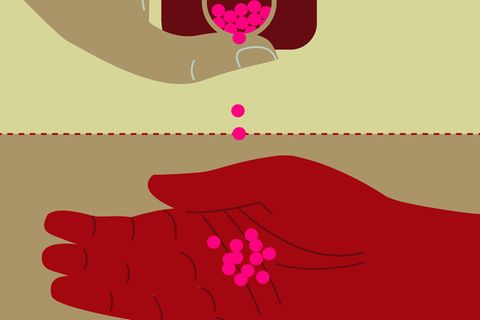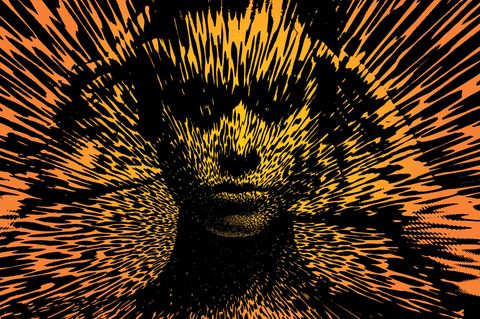Die Hoffnung ist klein: Nur wenige Zentimeter reckt sich Ecteinascidia turbinata vom Meeresgrund empor. Taucher entdecken die in Kolonien lebende Seescheiden-Art mit etwas Glück vor der Küste Kubas oder vor der Ostküste Floridas. Hell schimmern dort ihre transparenten, orangefarben gesäumten gallertigen "Mäntel" zwischen Seegras und Mangrovenwurzeln hervor. Auf den Wurzeln, aber auch auf unterseeischen Felsen in warmen Flachwasserzonen setzt sich die Manteltier-Kolonie fest.
Mit dem auffallenden Farbsaum warnen die Seescheiden ihre Fressfeinde – die dicht an dicht stehenden flaschenförmigen Einzeltiere schmecken scheußlich. Kaum ein Lebewesen knabbert deshalb an dem Manteltier. Forscher aber sehen in ihm großes Potenzial: Künftig könnte es einen Wirkstoff liefern gegen bestimmte durch Pilzinfektionen hervorgerufene Erkrankungen ("Mykosen"), die beim Menschen in einigen Fällen tödlich enden. Denn kein bekanntes Medikament wirkt bislang zuverlässig gegen Candida auris und Aspergillus fumigatus, zwei gefürchtete Krankenhauskeime.
Vor wenigen Monaten verkündeten Forscher der University of Wisconsin-Madison nun aber, dass sie aus dem Mikrobiom der Seescheide eine Substanz isolieren konnten, die im Laborversuch beide Pilze stoppte – und zudem von infizierten Mäusen gut vertragen wurde. Auch gegen 37 weitere Pilzarten war das Mittel unter Laborbedingungen meist erfolgreich.
Ein bedeutsamer Schritt, denn bislang stehen Medizinern nur drei wesentliche Substanzklassen von Antimykotika zur Verfügung. Ecteinascidia turbinata aber scheint einen neuen, bislang unbekannten Abwehrmechanismus einzusetzen. Das Meerestier könnte deshalb hilfreich sein bei Infektionen mit Pilzen, die bereits resistent sind gegen derzeit eingesetzte Medikamente. Das Team aus den USA hat den neuen Wirkstoff bereits zum Patent angemeldet – und ihn nach der kleinen Seescheide "Turbinmicin" getauft.

Medizin aus dem Meer: Immer mehr Forscher glauben, dass unter Wasser die Lösung für die Pharmakrise unserer Tage liegen könnte. Denn obwohl die Zahl der multiresistenten Keime steigt und für viele Krankheiten nach wie vor keinerlei wirksame Arzneimittel erhältlich sind, kommen immer weniger neue Präparate auf den Markt. Pilze und Bakterien aus der Natur gelten zwar als interessante Quelle für neue Substanzen. "Doch viele Ökosysteme an Land sind schon intensiv durchkämmt worden auf der Suche nach möglichen Wirkstoffen", erklärt Tim Bugni, Pharmazeut an der University of Wisconsin-Madison und Entdecker des Turbinmicins. "Die bakterielle Vielfalt im Meer dagegen ist riesig – und sie ist noch kaum erforscht." So wie er sieht eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern das Meer als bislang ungenutzte Wirkstoffkammer: Sie vermuten, dass sich dort zum Beispiel noch bis zu drei Millionen Bakterienarten finden lassen, außerdem mehr als 300000 verschiedene Algen und 5000 bislang unbekannte Korallen. Sie alle könnten Träger sein von Substanzen, die dem Menschen im Kampf gegen gefährliche Krankheiten helfen.
Neuartige Medizin gegen HIV und Corona?
Erste erfolgreiche Präparate nähren diese Hoffnung: Allein aus der Gruppe der Manteltiere sind bereits drei Mittel gegen Krebs auf dem Markt. Aus dem Gift der Kegelschnecke Conus magus, die im tropischen Pazifik heimisch ist, konnten Forscher ein besonders wirksames Mittel gegen schwerste Schmerzen entwickeln. Und eine Rotalge aus Neuseeland produziert eine Substanz, die – zumindest unter Laborbedingungen – gegen HIV zu wirken scheint. Insgesamt sind weltweit bereits 14 Präparate mit marinen Wirkstoffen erhältlich, 23 weitere befinden sich in klinischen Testphasen, darunter Mittel, die künftig gegen Krankheiten wie Alzheimer, ADHS oder Schizophrenie helfen könnten.
Die erstaunliche Wirksamkeit der Substanzen erklären Biologen mit dem speziellen Lebensraum der Meeresorganismen: Sie sind beständig umgeben von Wasser, das durchsetzt ist von Pilzen, Viren und Bakterien. Sesshaft lebende Tiere wie Korallen, Seescheiden oder Schwämme, aber auch langsame Meeresbewohner wie Schnecken, können zudem vor Konkurrenten und Fressfeinden nicht fliehen. Gegen diese Vielzahl an Gefahren und Erregern setzen die Lebewesen unter Wasser ein ganzes Arsenal von Wirkstoffen ein: Sie stoßen zum Beispiel schnell wirksame Toxine aus, um Fressfeinde zu verscheuchen, oder lassen sich von Bakterien und Pilzen besiedeln, etwa um kräftiger wachsende Nachbarn davon abzuhalten, sie zu überwuchern. Auf ihre Außenhaut legt sich dafür ein feiner Film voller bioaktiver Substanzen: Er bildet einen Schutzwall gegen das Wasser, das beständig neue Keime heranträgt.

Auch Menschen könnte dieser Schleim künftig schützen: Wissenschaftlerinnen der University of Florida untersuchten das Sekret von 300 verschiedenen Fischen – und entdeckten darin 200 Bakterien, manche von ihnen bislang unbekannt. "Je nachdem wo sie leben, entwickeln die Arten ganz unterschiedlichen Schleim: Küstenfische zum Beispiel tragen eine dünnere Schicht als Tiefseefische und müssen sich auch gegen ganz andere Erreger wappnen", erklärt Sandra Loesgen, Forscherin am Whitney Laboratorium der University of Florida, das sich ganz auf die Analyse von Meeresorganismen spezialisiert hat. Die Chemikerin hofft, im Schleim von Fischen Mikroben zu entdecken, aus denen sich Medikamente entwickeln lassen. Erste Ergebnisse ihrer Untersuchungen stimmen zuversichtlich: So trägt zum Beispiel der Brandungsbarsch Zalembius rosaceus ein Bakterium auf seiner Haut, das sowohl gegen bestimmte multiresistente Krankenhauskeime als auch gegen Darmkrebs zu helfen scheint. Noch ist laut Loesgen aber unklar, ob dieses Bakterium nur zufällig auf dem untersuchten Fisch siedelte oder fester Bestandteil seines Abwehrsystems ist. "Der Bakterienhaushalt von marinen Lebewesen ist noch kaum analysiert, wir stecken mitten in der Grundlagenforschung."
Natur als Vorbild - aber Herstellung im Labor
Die Wissenschaftlerin untersucht speziell Jungtiere, denn bei ihnen ist das Immunsystem noch nicht voll ausgereift. Die Haut der kleinen Fische trägt deshalb eine dickere Schleimschicht mit besonders vielen Abwehrstoffen. Auf dem Wattestäbchen einer ihrer Proben fanden sich sogar 23 verschiedene Bakterien. "Das ist eine sehr hohe Ausbeute, die wir aber brauchen, wenn man bedenkt, dass sich im Schnitt nur ein bis zwei Prozent aller Bakterien unter Laborbedingungen kultivieren lassen", so Loesgen.
Tatsächlich gilt die Entwicklung von Medikamenten aus dem Meer als besonders schwierig. Denn viele interessante Organismen lassen sich kaum über längere Zeit in Wasserbecken an Land halten oder gar in ausreichendem Maße nachziehen. Manche Schwämme etwa produzieren im Labor gar keine Toxine mehr: Weil ihre natürlichen Feinde fehlen, stellen sie die Abwehr ein. Oder Organismen setzen so geringe Mengen an Substanzen frei, dass Tonnen dieser marinen Lebewesen geerntet werden müssten, um daraus ein Präparat herstellen zu können – was ökologisch wie ökonomisch nicht hinnehmbar wäre.
Viele Forscher versuchen deshalb, die Wirkstoffe über eine Synthese im Labor oder auch mittels biotechnischer Produktion – mit modernen gentechnologischen Methoden – nachzubauen. Gleichzeitig bemüht sich die UNO um eine Vereinbarung zum Schutz der Meeresorganismen vor Bio-Piraterie: Sie sollen besser vor dem unkontrollierten Zugriff von Forschern und Pharmafirmen geschützt werden. Denn immer mehr Labore senden Tauchroboter aus, die Gesteinsbrocken von untermeerischen Felsen schlagen oder Sedimentproben aus dem Tiefseeboden greifen. Die gesammelten Proben werden anschließend auf dort lebende Organismen untersucht: Forscher schaben Bakterienfilme von Steinen, suchen unbekannte Algen auf Korallen, schneiden winzige Scheiben aus Schwämmen.
Irgendwo da draußen schwimmt er, der Wunderwirkstoff
Auch an deutschen Küsten sammeln Forscher Muscheln, Algen, Quallen und Würmer: In einer Blasentang-Art der Ostsee etwa entdeckten Mitarbeiter des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel vor Kurzem eine Pilzgattung, die gegen Hautkrebs zu helfen scheint – weitere Untersuchungen stehen aus. Nur eine von 10000 geprüften Substanzen aus marinen Organismen gelange überhaupt zur Marktreife, schätzt die Meeresbiologin Frauke Bagusche. Und auch Forscherin Loesgen räumt ein, dass noch völlig offen sei, ob sich aus Fischschleim jemals wirklich ein medizinisches Präparat entwickeln lasse. Aber die Chemikerin ist optimistisch: "Ich bin sicher: Irgendwo da draußen schwimmt der nächste großartige Wirkstoff!"