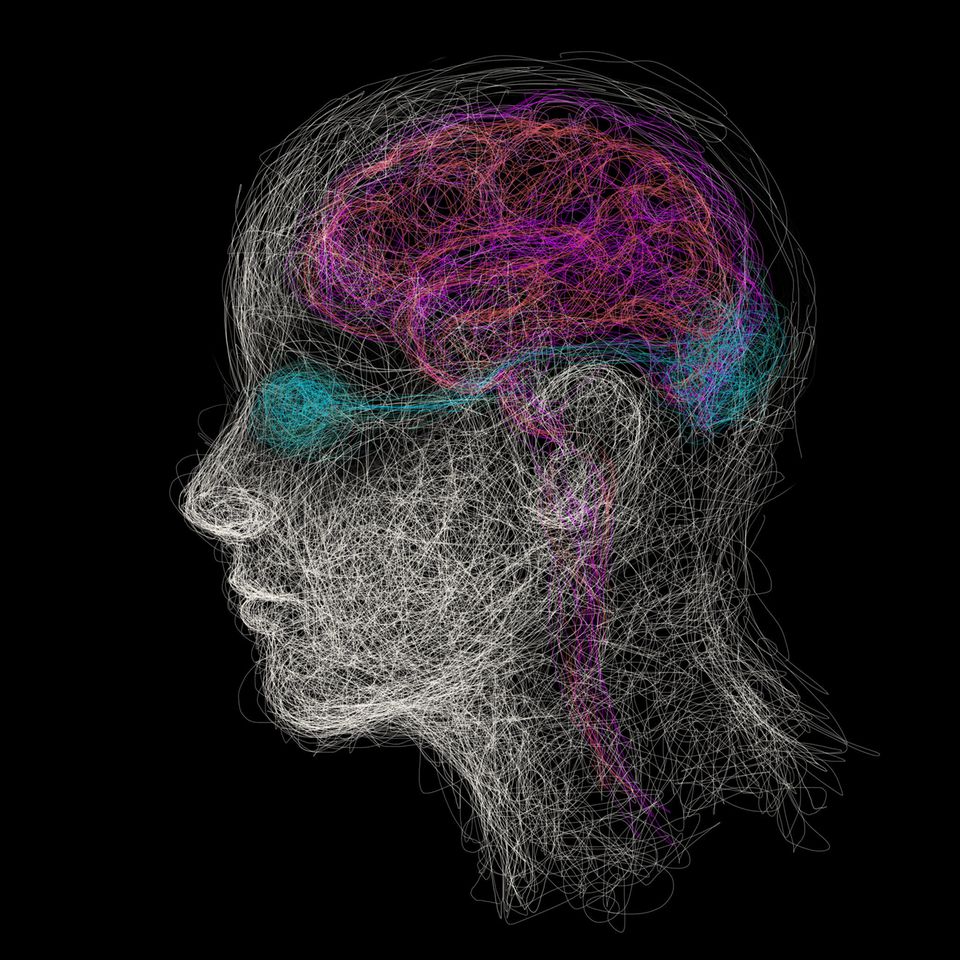Es ist eine uralte Idee und ein gefährliches Vorurteil: dass sich das "Böse" im Gesicht, am Schädel, vielleicht sogar direkt im Gehirn eines Menschen ablesen lasse. Im 19. Jahrhundert versuchte die sogenannte Phrenologie, aus der Form des Kopfes auf den Charakter zu schließen: ein pseudowissenschaftlicher Irrweg, der lange nachwirkte.
Heute hingegen stehen der Forschung andere Mittel zur Verfügung: Hochauflösende MRT-Aufnahmen, offene Datenbanken wie der Julich-Brain-Atlas – und ein neues, vorsichtigeres Verständnis davon, was Persönlichkeit ausmacht. Dennoch bleibt die Frage bestehen: Gibt es im Gehirn von Menschen mit stark antisozialem Verhalten messbare Unterschiede?
Eine neue Studie, erschienen in "European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience", liefert darauf nun eine bemerkenswerte Antwort.
Zwei Gesichter der Psychopathie
Psychopathie ist kein eindeutig diagnostizierbares Krankheitsbild, sondern ein psychologisches Konstrukt, das sich durch eine auffällige Mischung aus Gefühlskälte, Manipulation und antisozialem Verhalten auszeichnet. Menschen mit psychopathischen Zügen wirken häufig charmant, wortgewandt und selbstbewusst – und sind zugleich unfähig zu echter Empathie. Sie lügen pathologisch, empfinden keine Reue, verletzen soziale Regeln mit frappierender Gleichgültigkeit und neigen zu impulsivem oder gar gewalttätigem Verhalten.
Erfasst wird das Persönlichkeitsprofil oft mit der sogenannten Psychopathy Checklist (PCL-R), die zwei zentrale Dimensionen unterscheidet: Faktor 1 beschreibt emotionale und interpersonelle Merkmale wie Empathiemangel oder oberflächlichen Charme, Faktor 2 hingegen spiegelt impulsives, verantwortungsloses und gewalttätiges Verhalten wider.
Genau hier setzt die neue Studie an.
Was Hirnscans verraten
Das internationale Forschungsteam unter Leitung des Forschungszentrums Jülich analysierte MRT-Aufnahmen von 39 erwachsenen Männern mit hohen Psychopathie-Werten und verglich sie mit einer sorgfältig abgestimmten Kontrollgruppe. Der Fokus lag auf strukturellen Unterschieden im Gehirn – insbesondere im Zusammenhang mit stark ausgeprägtem antisozialen Verhalten (Faktor 2).
Tatsächlich zeigte sich: Je höher der Faktor-2-Wert, desto geringer das Volumen in bestimmten Hirnregionen. Betroffen waren vor allem Areale, die für Impulskontrolle, Emotionsregulation und soziales Verhalten zuständig sind, darunter die Basalganglien, der Thalamus, der Hirnstamm (Pons) sowie kortikale Strukturen wie der orbitofrontale und der insuläre Kortex. Auch das Kleinhirn war involviert.
Selbst das gesamte Gehirnvolumen war in der Psychopathie-Gruppe messbar reduziert – mit einem besonders markanten Unterschied im rechten Subikulum, einem Teil des Hippocampus, der unter anderem für Gedächtnis und Orientierung wichtig ist.
Was Hirnveränderungen über Verhalten verraten können
Was bedeuten diese strukturellen Abweichungen? Noch lässt sich keine einfache Kausalität ableiten, aber viele der betroffenen Regionen sind funktionell gut erforscht. Der orbitofrontale Kortex etwa spielt eine Schlüsselrolle bei der Bewertung von Handlungsfolgen und beim sozialen Lernen. Ist seine Aktivität oder Struktur eingeschränkt, fällt es schwerer, Schuld oder Konsequenzen zu antizipieren.
Die Basalganglien und der Thalamus wiederum sind Teil jener neuronalen Netzwerke, die Handlungsimpulse filtern – eine Art inneres Bremssystem. Ein geringeres Volumen könnte auf eine verminderte "Kontrollkapazität" hindeuten, etwa bei Wut oder Aggression.
Allerdings betonen die Forschenden selbst: Solche Korrelationen sage noch nichts über Ursachen aus. Ob die Veränderungen angeboren sind, durch Erfahrungen verstärkt wurden oder mit anderen psychischen Faktoren zusammenhängen, bleibt offen.
Keine einfachen Antworten
Für die emotionalen und interpersonellen Merkmale (Faktor 1) fielen die Zusammenhänge schwächer aus. Zwar zeigten sich auch hier in Einzelfällen Volumenveränderungen – etwa im linken Hippocampus und im frontalen Kortex –, doch das Bild blieb uneinheitlich.
"Ein einzelnes Zentrum für Psychopathie gibt es nicht", sagt Studienleiterin Katrin Amunts vom Forschungszentrum Jülich. Vielmehr gehen die Fachleute von einem Netzwerk aus verschiedenen Strukturen aus, das bei bestimmten Persönlichkeitsprofilen verändert ist. Und auch das nur in Wahrscheinlichkeiten, nicht in absoluten Kategorien.
Was die Forschung erreichen will
Die Autorinnen und Autoren betonen, dass ihre Ergebnisse nicht zur Stigmatisierung beitragen sollen. Vielmehr gehe es darum, die biologischen Grundlagen antisozialer Verhaltensweisen besser zu verstehen und langfristig auch therapeutische Ansätze zu entwickeln, die präziser greifen.
Dazu soll der Julich-Brain-Atlas weiterentwickelt und für andere Forschende offen nutzbar bleiben. Denn eines zeigt die Studie eindrucksvoll: Was einst Spekulation war, lässt sich heute immer besser sichtbar machen – wenn man die richtigen Werkzeuge hat. Und die nötige Vorsicht.