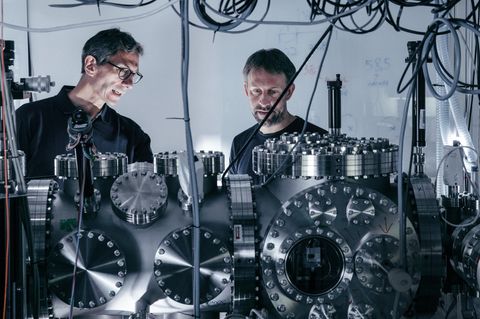Der Bericht ist 33 Seiten lang, immerhin sechs Forscher und Wissenschaftlerinnen haben ihn verfasst. Sie arbeiten in renommierten Instituten und Behörden: im Umweltbundesamt und im Deutschen Geoforschungszentrum, in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sowie in Landesbergbauämtern. Vier Jahre lang hatten sie sich im Auftrag des Bundestags mit "Hydraulic Fracturing", kurz "Fracking", beschäftigt, der Erdgasförderung aus Schiefergasgestein. Am 30. Juni 2021 legten sie den Volksvertretern ihre Ergebnisse vor.
Sie schlossen mit einer dringlichen Bitte: Der Bundestag möge umgehend entscheiden, ob das Fracking-Verbot von 2017 bestehen bleiben solle. Nicht nur habe sich die klimapolitische Lage verändert, auch die Technik zur Erschließung von Schiefergas habe sich deutlich weiterentwickelt. Die Umweltrisiken ließen sich inzwischen minimieren.
Doch die Bitte der "Expertenkommission Fracking" verhallte. Denn das öffentliche Urteil über die Abbaumethode war da schon längst gefällt: Sie sei umweltschädlich und potenziell gefährlich. Die Technik löse Erdbeben aus, verursache klimaschädliche Methan-Lecks, gefährde die Reinheit des Grundwassers. Fracking: eine Technik des untergehenden fossilen Zeitalters, nicht einer grünen Zukunft.
Ein Jahr später sind viele Gewissheiten zertrümmert: Wladimir Putin ließ die Ukraine angreifen; wegen des Gasmangels haben Bevölkerung und Unternehmer Angst vor dem Winter. Nun stellt sich die Frage neu: Ist das Fracking-Verbot noch sinnvoll?