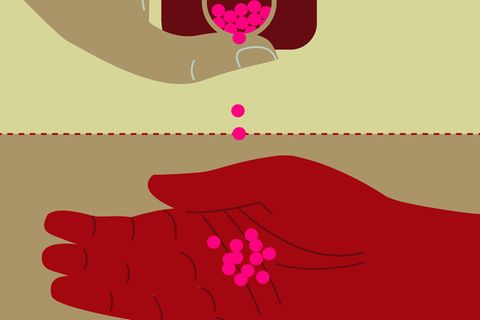Folgt man den nüchternen Fakten, ist die Lage ziemlich klar: Vegetarierinnen und Vegetarier liegen mit ihrer vornehmlich auf Pflanzenkost beruhenden Ernährungsweise in vielen Belangen deutlich vorn. Sie nehmen durchschnittlich weniger Nahrungsenergie, Eiweiß und Fett zu sich. Das schützt vor Übergewicht und Fettleibigkeit, die als Risikofaktoren für eine Reihe von Krankheiten gelten. Menschen, die sich vegetarisch ernähren, leiden seltener an Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was sie nicht allein ihrer meist schlanken Statur verdanken. Unabhängig vom Körpergewicht wirkt sich offenbar auch der Verzicht auf Fleisch aus.
Und nicht zuletzt machen sich Pflanzenköstler weniger mitschuldig am Töten, an Tierhaltung, wie sie in den Industrieländern betrieben wird, mit Massenställen, Intensivmast, Überzüchtung, Tiertransporten. Einer Studie zufolge haben sich fast zwei Drittel aller Vegetarier vor allem aus ethischen Gründen für die nichtfleischliche Ernährung entschieden, nur gut jeder Fünfte aus gesundheitlichen. Auch in ökologischer Hinsicht ist Vegetarismus sinnvoll: Massentierhaltung gilt als ein wesentlicher Verursacher von Treibhausgasemissionen.
Viele würden gern dauerhaft auf Fleisch verzichten, werden aber rückfällig
Gleichwohl stellen Vegetarierinnen und Vegetarier global betrachtet nach wie vor eine Minderheit. In den USA machen sie etwa drei bis vier Prozent der Bevölkerung aus. In Großbritannien sind es 2,3 Prozent aller Erwachsenen. Hierzulande geben im Jahr 2023 immerhin 8,2 Millionen Menschen an, völlig oder weitgehend auf Fleisch zu verzichten. Doch selbst in dieser Gruppe, so enthüllen Befragungen, gelingt die Umstellung vielfach weniger konsequent als erwünscht.
Ein großer Anteil (etwa 48 bis 64 Prozent) der sich selbst zum Vegetarismus bekennenden Personen gibt an, gelegentlich Fisch, Geflügel oder rotes Fleisch zu essen – ein Hinweis darauf, dass Umweltfaktoren oder biologische Zwänge den Wunsch nach einer strikten pflanzenbasierten Ernährung offenbar immer wieder überlagern.
Forschende stellen Zusammenhang zwischen Ernährungspräferenz und Genen her
Dass insbesondere physiologische Merkmale unsere Lust auf Fleisch beeinflussen könnten, untermauert eine jüngst im Fachblatt PLOS veröffentlichte Studie von Forschenden der Northwestern University in Chicago. Dem Team um Hauptautor Nabeel Yaseen gelang es erstmals, eine potenzielle genetische Veranlagung zu identifizieren, die es einzelnen Menschen offenbar leichter macht, gänzlich auf Tierisches zu verzichten. Dazu glichen die Wissenschaftler das genetische Profil von 5324 strengen Vegetarierinnen und Vegetariern mit den Erbanlagen von knapp 300 000 Kontrollpersonen ab. Die Daten bezog das Team aus einer britischen Gesundheitsdatenbank, in der Informationen von über einer halben Million Briten erfasst sind.
Demnach fand das Team bei jenen Menschen, die sich fleischlos ernähren, eine Häufung spezieller Genvarianten, die unter anderem mit dem Fettstoffwechsel und bestimmten Gehirnfunktionen in Verbindung stehen. Dieser Zusammenhang lässt insofern aufhorchen, als es unter anderem komplexe Fettmoleküle sind, die fleischliche von pflanzlicher Kost unterscheiden. "Meine Vermutung ist, dass es Lipidkomponenten im Fleisch gibt, die manche Menschen benötigen. Und vielleicht sind Menschen, deren Genetik Vegetarismus begünstigt, in der Lage, diese Komponenten endogen zu synthetisieren", sagt Studienleiter Yaseen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei das jedoch reine Spekulation – es müsse noch viel mehr geforscht werden, um die Physiologie des Vegetarismus zu verstehen.

Klar sei jedoch, dass der treibende Faktor für die Vorliebe von Lebensmitteln und Getränken nicht nur ihr Geschmack ist, sondern auch die Art und Weise, wie der Körper eines Menschen sie verstoffwechselt, so Yaseen. Hier scheint das jeweilige genetische Profil eine gewichtige Rolle zu spielen. Mit anderen Worten: Womöglich sind nicht alle Menschen gleichermaßen in der Lage, sich auf Dauer strikt pflanzenbasiert zu ernähren. Zumindest könnte es manchen aufgrund ihrer individuellen biologischen Veranlagung schwerer fallen als anderen – so sehr sie auch von moralischen Überzeugungen motiviert sein mögen.
Erst hoher Fleischkonsum verringert die Lebenserwartung
Kein Wunder also, wenn bei Neu-Vegetariern am Ende oft der Appetit über den erklärten Willen und besseres Wissen siegt – und viele irgendwann doch wieder an der Currywurstbude stehen. Wer in erster Linie aus gesundheitlichen Gründen versucht, auf Wurst, Speck und Co zu verzichten, sollte sich ohnehin nicht grämen, wenn er gelegentlich doch zu einem Steak greift. Deutlich negative Effekte etwa auf die Lebenserwartung zeigen sich in Untersuchungen meist erst bei hohem Fleischkonsum.
Die Zukunft könnte deshalb den Flexitariern gehören. Also jenen Menschen, die Vegetarismus in Teilzeit praktizieren. Mit Fleisch als gelegentlicher Beilage – und nicht als Hauptmahlzeit.