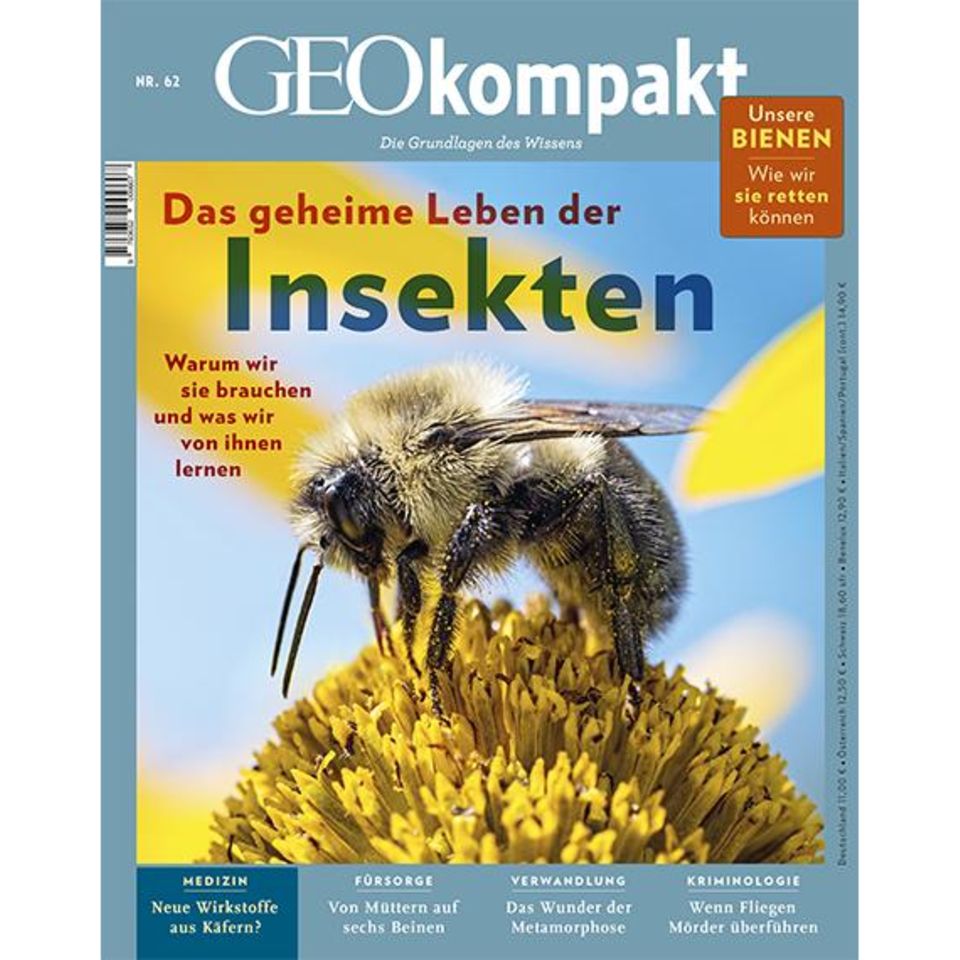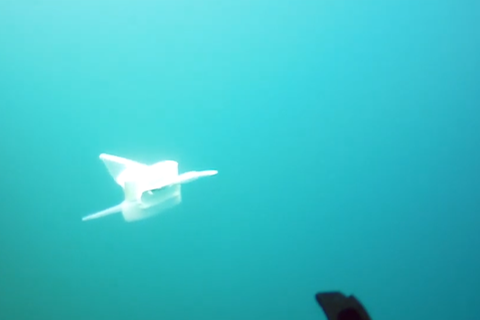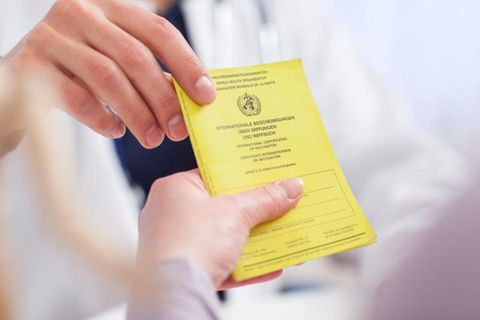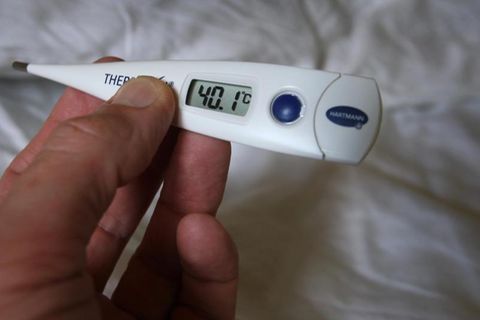GEOkompakt: Herr Professor Vilcinskas, seit Jahrzehnten beschäftigen Sie sich mit sechsbeinigen, zumeist geflügelten Krabbeltieren. Was fasziniert Sie so sehr an Insekten?
Prof. Andreas Vilcinskas: Mit rund einer Million bekannter Spezies stellen Insekten die artenreichste Tiergruppe auf der Erde dar. Jede zweite bekannte Art ist ein Insekt. Der Formenreichtum, den die Sechsbeiner hervorgebracht haben, ist schier überwältigend. Je nach Lebensweise haben manche im Laufe der Evolution zum Beispiel riesige Flügel bekommen – so etwa viele Schmetterlinge. Andere, wie Bienen, besitzen schmalere, rasch schlagende Flügel. Bei Fliegen wiederum ist das zweite Flügelpaar umgebaut zu winzigen Sensoren, die hochpräzise Flugmanöver erlauben. Und Flöhe dagegen können gar nicht fliegen, sie haben ihre Flügel in der Evolution wieder verloren.
Dafür springen sie ziemlich gut.
Genau. Die Extremitäten sind ein weiteres Beispiel für den extremen Formenreichtum vieler Insekten. Heuschrecken besitzen kräftige Sprungbeine, Laufkäfer und Ameisen haben Rennbeine, Gottesanbeterinnen können in Sekundenbruchteilen andere Insekten mit ihren Fangbeinen erbeuten, Läuse halten sich mit ihren Klammerbeinen an Haaren fest. Und auch die kompliziert aufgebauten Mundwerkzeuge sind äußerst variantenreich. Da gibt es mächtige Kieferklauen, Stechapparate oder alle möglichen Formen von Rüsseln.
Wie kommt es zu dieser spektakulären Fülle verschiedener Formen?
Eine Ursache liegt in dem speziellen Bauplan der Insekten, der bei allen Arten – ob Gottesanbeterin, Ameise oder Schmetterling – vergleichbar ist. Die erwachsenen Tiere sind in drei Teile gegliedert. Vorn sitzt der Kopf. An den schließt sich der Brustkorb an. Und an dem wiederum hängt der Hinterleib. Wie Module können die einzelnen Einheiten je nach Lebensweise abgewandelt werden. Und dadurch eine immense Vielfalt hervorrufen. Dieses ebenso schlichte wie geniale Bauprinzip ermöglichte es den Insekten, nahezu jede Nische auf unserem Planeten zu erobern. Heute siedeln sie in jeder Wüste, in Steppen, Gebirgen, sämtlichen Wäldern und auch in Flüssen und Seen. Ja, selbst bis in die Polarregionen sind einige Insekten vorgedrungen. So gibt es zum Beispiel eine Zuckmückenart, die sich in der Antarktis wohlfühlt. Nur in Meeren findet man kaum Insekten.
Weshalb?
Als die Insekten vor etwa 480 Millionen Jahren entstanden, waren die marinen Lebensräume bereits von anderen höchst erfolgreichen Gliedertieren besetzt: von Krebstieren, Verwandten der Insekten. Aller Wahrscheinlichkeit nach war diese Konkurrenzsituation zu hart. An Land hingegen konnten sie sich optimal entfalten. Und regelrechte Prachtexemplare hervorbringen. Zum Beispiel Thysania agrippina – auch als Weiße Hexe bezeichnet – ein nachtaktiver südamerikanischer Falter mit einer Flügelspannweite von mehr als 30 Zentimetern: eines der größten Insekten weltweit. Ebenfalls beeindruckend und in Südamerika heimisch ist der faustgroße Herkuleskäfer, der trotz seines bulligen Körpers fliegen kann. Es ist schon sehr imposant, wenn solch ein Insektengigant mit einem durchdringenden Knattern durch den Dschungel fliegt.

Aus welchem Grund werden Insekten nicht noch größer?
Die Größe ist limitiert durch das Atmungssystem der Insekten, das weniger effektiv ist als bei Tieren, die eine Lunge besitzen. Die Sechsbeiner atmen durch Tracheen. Das sind feine Röhren, durch die Luft von außen strömt und die sich im Körper der Insekten immer weiter verzweigen. Vor Jahrmillionen, als der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre deutlich höher lag, entwickelten sich auch größere Insekten – etwa Libellen mit einer Flügelspannweite von 70 Zentimetern. Solche Exemplare finden Forscher heute als fossile Abdrücke in Steinablagerungen. Aber vielleicht noch spannender: Ständig entdecken sie auch neue, lebende Spezies. Denn längst nicht alle Arten sind beschrieben.
Auf wie viele neue Arten stoßen Forscher im Jahr?
Einige Tausend! Selbst bei uns in Deutschland werden noch neue Arten entdeckt. Es kommt eben immer darauf an, welchen Lebensraum sich Forscher genau anschauen. Und hierzulande ist etwa die Fauna der Baumkronen noch gar nicht vollständig erfasst. Manchmal stellen Wissenschaftler, zum Beispiel mittels genetischer Analysen, auch fest, dass hinter einer bereits beschriebenen Spezies gleich mehrere Arten stecken. Die lassen sich schlichtweg äußerlich kaum voneinander unterscheiden. Und doch spielt jede einzelne Spezies eine bestimmte Rolle im Ökosystem. Insekten sind zu einer so bedeutsamen Gruppe von Tieren aufgestiegen, dass man sie ohne Zweifel als systemrelevant bezeichnen kann.
Wie meinen Sie das?
Alle Landlebensräume sind von Insekten abhängig. Denken Sie zum Beispiel an die Blütenpflanzen, die mit mehr als 200 000 Spezies das Gros der Flora stellen. Ohne Insekten würde es sie gar nicht geben. Schließlich haben sich die beiden Gruppen in einem gemeinsamen evolutionären Prozess entwickelt: Insekten wie Bienen oder Schmetterlinge bestäuben die Pflanzen, helfen den Gewächsen also beim Sex. Dafür bekommen sie in der Regel nahrhaften Nektar. Darüber hinaus spielen Insekten eine extrem wichtige Rolle bei der Biokonversion, also der Zersetzung von organischem Material, etwa Laub und Totholz im Wald.

Welche Insekten haben sich darauf spezialisiert?
Zum Beispiel Springschwänze, das sind womöglich die am meisten unterschätzten Insekten, denn dem Laien sind sie kaum bekannt. Diese winzig kleinen, flügellosen Urinsekten kommen millionenfach in jedem Kubikmeter Waldstreu vor – und verdauen abgestorbene Pflanzenreste. Aber auch viele Larven von Käfern leben in toten Stämmen und zersetzen dort Holz. Dass die Larven von Insekten oft eine vollkommen andere Lebensweise verfolgen als die erwachsenen Tiere, ist ein weiteres Geheimnis ihres Erfolgs. Denn damit gehen sich Erwachsene und Nachwuchs aus dem Weg, konkurrieren nicht um Nahrung. Raupen fressen Pflanzen, Schmetterlinge schlürfen Nektar. Mückenlarven leben im Wasser, die Erwachsenen an Land. Und noch etwas trägt maßgeblich zum Erfolg bei: Insekten sind Meister darin, mit Mikroorganismen zusammenzuarbeiten. Fast alle Insekten nutzen in ihrem Darm Bakterien und andere Mikroben, um sich an bestimmte Lebens- und Ernährungsweisen anzupassen.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Kleidermotten sind sehr erfolgreiche Insekten, ihre Larven vertilgen Textilien. Doch haben die Insektenlarven selbst das Arsenal an Enzymen entwickelt, um die Textilien zu verdauen? Nein, sie beherbergen in ihrem Darm spezielle Mikroorganismen, die dafür nötige Substanzen bilden. Bei Termiten ist es ähnlich. Sie haben Holz als Nahrungsquelle erschlossen, eine praktisch unbegrenzte Ressource. Das ist ihnen aber nur deshalb gelungen, weil der Termitendarm einem winzigen Bioreaktor gleicht. Darin gedeiht eine ganz bestimmte Flora von Mikroorganismen, die hochwirksame, Holz zersetzende Stoffe produzieren.
Sie haben das weltweit erste Institut für Insektenbiotechnologie gegründet. Woran arbeiten Sie?
Eines unserer Forschungsobjekte ist der Totengräberkäfer – ein Insekt, das eine hochfaszinierende Lebensweise verfolgt! Die Käfer können über Kilometer hinweg riechen, ob ein Kadaver im Wald liegt – zum Beispiel eine tote Maus. Meist werden gleich mehrere Käfer angelockt. Sobald die Insekten auf dem Aas landen, springen von ihrem Rücken kleine Mitreisende ab: Milben, die sofort über die Maus krabbeln und Eier von Aasfliegen – Konkurrenten des Totengräbers – fressen. Die Käfer beginnen nun, die Maus im Waldboden einzubuddeln. Normalerweise verwest vergrabenes Aas. Doch die Käfer benetzen die ganze Maus mit einem speziellen Sekret und konservieren sie somit. Der Grund: Sie brauchen etwas Zeit, denn sie paaren sich jetzt – und legen schließlich Eier auf der Maus ab. Sobald nun aus den Eiern Larven schlüpfen, speicheln sie die Maus erneut ein. Woraufhin sich das tote Fleisch verflüssigt. Ein Festmahl für Eltern und den hungrigen Nachwuchs. Das Ganze ist eine einzigartige Meisterleistung und eine biochemische Schatztruhe, von der wir Menschen profitieren könnten.

Von einem Käfer, der Mäuse verflüssigt?
Ja! Nirgendwo sonst in der Natur verdaut ein Tier ein so viel größeres Tier direkt vor seinem Maul. Es ist so, als würde ich Sie anspucken – und Sie würden sich vor meinen Augen auflösen. Mit modernen Laboranalysen untersuchen wir, wie genau der Käfer die Konservierung und Verflüssigung bewerkstelligt. Allein die Formel eines organischen Konservierungsmittels, das Fleisch über eine so lange Zeit haltbar macht, wäre Millionen wert. Und mit Stoffen, die Fleisch verflüssigen, ließen sich Reste in der Lebensmittelindustrie aufarbeiten. Im Speichel des Käfers haben wir schon mehr als 30 konservierende Substanzen entdeckt.
Das gesamte Interview finden Sie in GEOkompakt "Das geheime Leben der Insekten".