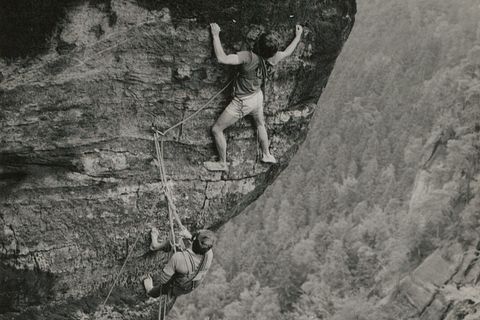Wir gehen endlose Flure entlang, mit Filzpantoffeln an den Füßen, um den polierten Granitboden nicht zu zerkratzen. Vor uns schwebt unsere Führerin, in eine Tracht aus mintgrüner Ballonseide gehüllt. Niemand spricht, nur das Rascheln ihres Kleides ist zu hören, das Klicken unsichtbarer Schalter, wenn wir eine Lichtschranke passieren. Ein unterirdischer Palast, 400 Meter tief in den Berg getrieben, und irgendwo dort drinnen: Er. Eine Vorhalle, der Fußboden nun aus Marmor. Eine Frau sitzt an einem niedrigen Tisch über ein zerlesenes Buch gebeugt, dessen Papier sich unter ihren Fingern auflöst. Als wir uns nähern, erhebt sie sich, ohne zu lächeln.

Sie hat nur eine Aufgabe: Die Flügeltür an der Stirnseite der Halle zu öffnen. Dazu trägt sie weiße Baumwollhandschuhe, um die Messinggriffe nicht zu beschmutzen. In der Halle, auf einem kleinen Erdhügel mit echten Birken und lilafarbenen Blumen, steht Er im Licht eines frischen, kühlen Morgens in den Bergen. Im Hintergrund das Gemälde eines Sees und schneebedeckter Gipfel. Er trägt eine Goldrandbrille und einen graphitfarbenen Anzug, hält die Hände hinter dem Rücken verschränkt.
Bei der Verbeugung sind 45 Grad Vorschrift
Der Raum misst gut zehn Meter bis zur Decke. Wind aus einem Ventilator fächelt die Birkenblätter, das 24-Kanal-Mischpult ist im Gebüsch versteckt. Im Marmorboden ist ein heller Balken eingelassen, davor hängt, an zwei Chrompfosten befestigt, eine Kordel. Das ist der Platz für die Verbeugung: 45 Grad abgewinkelt an der Hüfte, den Blick gesenkt. Am 8. Juli 1996, dem zweiten Jahrestag seines Todes, ist Kim Il-sung, der "Große Führer" Nordkoreas und Vater des jetzigen Diktators Kim Jong-il, also auch hier wieder auferstanden: als Geschenk der KP Chinas.
Die Bienenwachsfigur im Maßanzug, ausgestellt in Koreas "Museum der Völkerfreundschaft", gleicht dem echten Kim Il-sung so sehr, dass Koreanern der Atem stockt, wenn sie den Raum betreten. "Viele beginnen zu weinen", flüstert unsere Führerin. Gern würde ich einen weinenden Koreaner befragen, doch da ist niemand. Tausende besuchten das Museum jeden Tag, nur eben heute nicht, versichert unsere Führerin. Sie ist ohnehin die Einzige, die hier die Erlaubnis hat, mit uns zu sprechen; weitere Interviews sind im Protokoll nicht vorgesehen.
Zwei Bewacher, 70 Genehmigungen
Ausländische Journalisten sind in Nordkorea unerwünscht und werden meistens abgewiesen. Als wir den Gott aus Bienenwachs besuchen, sind wir die einzigen Reporter im Land. Wir haben zwei Wochen Zeit und reisen wie auf Staatsbesuch: Wo wir auch hinkommen, ist der Tisch gedeckt, sind die Uniformknöpfe poliert, fangen Kinder an zu singen. Zwei Begleiter und ein Chauffeur holen uns am Flughafen ab und weichen nie von unserer Seite. Sie haben unseren Besuch seit Wochen vorbereitet und mehr als 70 Genehmigungen eingeholt. Eine zum Beispiel dafür, die U-Bahn benutzen zu dürfen. Allein die Erlaubnis für einen Flug ins Gebirge umfasst 24 Seiten. Was wir nicht sehen dürfen, nehmen wir überall als Schattenriss wahr:
Über zehn Atomwaffen soll das Land verfügen; wir sehen Raketen auf einem Gemälde im Kindergarten. Mindestens eine Million Menschen sind in den vergangenen Jahren an Hunger gestorben; wir sehen die Entbehrungen in den ausgezehrten Körpern der Kinder, die neben der Autobahn im Dreck stehen und Mais verkaufen. 100 000 Menschen schuften sich in Arbeitslagern langsam zu Tode; wir sehen die Angst im Auge unserer Gegenüber, die Furcht aller, etwas Falsches zu sagen. Was wir sehen dürfen, ist wo irgend möglich frisch gestrichen. Eine Inszenierung, ein Schauspiel, das Lebenswerk des Kim Il-sung, der angeblich 10 000 Bücher geschrieben hat: ein Theaterstück mit 23 Millionen Statisten.
Ein sozialistisches Disneyland
Ein Land, ein Volk, nach seinem Bild geformt. Viel Blut und viele Tränen, doch nimmt alles ein gutes Ende. Das behaupten jedenfalls die beiden Vorleser, die uns begleiten. Allein die Kulissen zu bauen, muss ein halbes Menschenleben gedauert haben. Pjöngjang, die Hauptstadt, war der Stolz des Kim Il-sung; 30 Stockwerke recken sich die Häuser am Taedong-Fluss in die Höhe. Der Triumphbogen ist größer als das Original in Paris.
Sechsspurige Boulevards durchkreuzen die Stadt, auf Kreuzungen regeln Politessen in weißen Uniformen den kaum vorhandenen Verkehr, drehen sich kreiselflink um die eigene Achse. Pressen dabei die Lippen aufeinander. Eine Sirene ruft die Menschen jeden Morgen um sieben Uhr zur Arbeit, sie gehen eiligen Schritts. Vor dem Kulturzentrum exerziert eine Kompanie von Soldaten in schlammbraunen Uniformen. Keine Armee der Welt zelebriert den Gleichschritt mit mehr Hingabe: Nur ein Schritt ist zu hören, wenn Nordkoreas Soldaten marschieren.
Vorbei an Militärposten fahren wir aufs Land, kilometerweit wird die Autobahn nach Osten von orangefarbenen Astern gesäumt, im Abstand einer Handbreit neben der Betonpiste gepflanzt. Immer wieder passieren wir Frauen, die mit Reisigbesen die Straße fegen, kein Blatt, kein Steinchen liegen lassen.
Überall der Geruch frischer Farbe
Von der Königin von England heißt es, sie habe auf Reisen stets den Geruch frischer Farbe in der Nase: Wo sie auch hinkomme, seien die Wände frisch gestrichen. Ähnlich fühlen wir uns nun. Als wir den Bauern Yun Chang-guk treffen, klebt die Tür seines Hauses beim Öffnen noch leicht am Rahmen, Handwerker erneuern die Fenster. Wir fragen nach Familienfotos. Sie hängen an der Wand und zeigen, dass die Yuns schon länger hier wohnen. Yun Changguk scheint dem Traum des Kim Il-sung so nahe zu kommen, dass wir ihn alles fragen dürfen.
Dies also ist ein gottgefälliges Leben: Yun Changguk, geboren 1965, Vater Brigadeleiter, Mutter Landarbeiterin. Mit 15 feiert er das Erwachsenwerden mit Gleichaltrigen in der Gemeindehalle: Er schwört, sein Leben Volk und Führer zu weihen. Vielleicht schläft er noch im Bett der Eltern zu dieser Zeit; Koreaner werden spät erwachsen. Danach geht er zur Armee, ist fünf Jahre lang unter Soldaten, darf seine Familie nie besuchen. Er wird Mitglied der Partei. Als er zurückkehrt, bietet ihm der Heiratsvermittler eine Frau an. Yun Chang-guk heiratet, zeugt drei Kinder, schließt die Landwirtschaftsschule ab und erhält dafür vom Großen Führer einen Fernsehapparat. Der steht im Wohnzimmer.
Woran kann sich Yun Chang-guk erinnern aus seiner Kindheit, außer an die Jugendweihe? An ein Ereignis, das Jahre vor seiner Geburt stattfand. Weil es die Alten im Dorf so oft erzählt haben, dass es ihm ist, als sei er dabei gewesen. 1952, an einem sonnigen Septembertag, besuchte der Große Führer die Chonsam-Kooperative: 500 Hektar, 500 Familien, eine Flussebene, eingerahmt von einer Hügelkette. Der Reis stand ein wenig schäbig, aber Er sah einen Baum, auf dem reife, orangefarbene Persimonen hingen. Er sagte wohl: Die Persimonen sehen gut aus, warum pflanzt ihr nicht mehr davon? Er hat zu euch gesprochen, Nichtswürdige, flüsterten die Sekretäre des Großen Führers, würdigt es gefälligst.
Und die Bauern legten einen Garten an, in dem nie eine verdorrte Blume stehen würde. Sie mauerten eine sieben Meter hohe Wand, auf der die besten Künstler ein Mosaik legten, das den Großen Führer zeigt, in einem Hain blühender Persimonenbäume. Neben den Baum setzten sie einen Findling, in den sie eingravierten, dass der Herr die Zahl der Früchte auf dem Baum auf 800 geschätzt hatte. Als die Bauern den Baum abernteten, waren es genau 803. Danach haben sie Hunderte neue Persimonenbäume gepflanzt.
Kim Il-sung ist nicht tot
Zwölf Jahre nach dem Ableben des geliebten Führers ist es, als wäre er nie gestorben: Kein Tag vergeht, an dem wir nicht Dutzende Male in sein Antlitz blicken. Alle Erwachsenen tragen sein Bildnis als Anstecknadel am Revers, nur an der Arbeitskleidung nicht, um das Bild nicht zu beschmutzen. In allen Kindergärten, Schulen, in jedem Wagen der Pjöngjanger U-Bahn, in allen Wohnzimmern hängt ein Porträt des Staatsgründers. Es soll im Land 35 000 Monumente zu seinen Ehren geben, die größten so hoch wie zehnstöckige Häuser. Zeitungen, in denen sein Bild erscheint, dürfen nicht weggeworfen werden. Briefmarken mit seinem Abbild können nicht benutzt werden, weil kein Postbeamter es wagen würde, einen Stempel in das Gesicht des Großen Führers zu setzen.
Auf unserer Fahrt sehen wir weiße Felsen mit roter Inschrift. Diese "Vor-Ort-Anweisungen" geben wieder, was Kim Il-sung irgendwann einmal an dieser Stelle gesagt haben soll. Manche Steine sind zehn Meter breit; der Granit offenbart eine panische Angst vor Vergänglichkeit. Manchmal sind links und rechts Bäume gepflanzt, deren Kronen sich über dem Stein berühren. An Feiertagen liegen frische Blumen davor, oder es brennen Kerzen.
Wer Kim Il-sung nur als historische Figur begreift, wird nicht verstehen, warum die Augen vieler Nordkoreaner glänzen, wenn sie vom Großen Führer sprechen. Auch wenn die Verfassung das Land als sozialistischen Staat definiert - Nordkoreas Motto "Einer für Alle, Alle für Einen!" steht für das säkulare Äquivalent eines Gottesstaats. Kim Il-sung hat dieses Paralleluniversum erschaffen; Schöpfer und Prophet in einem, hat er auch die Heiligen Schriften geschrieben, über deren korrekte Auslegung die Ideologen bis heute debattieren. Wie Religionswächter achten Spitzel und Geheimpolizisten darauf, dass niemand vom Pfad der Tugend abweicht.
Die "Sonne des 21. Jahrhunderts"
Die Basis für diese religiöse Verehrung hat Kim Il-sung zu Lebzeiten gelegt, perfektioniert hat sie nach seinem Tod sein Stellvertreter auf Erden - Kim Jong-il, sein Erstgeborener, der sich von seinen Lakaien als "Sonne des 21. Jahrhunderts" titulieren lässt. Ausländische Beobachter gaben Kim Jong-il nach dem Tod seines Vaters am 8. Juli 1994 allenfalls Monate, bevor ihm die Macht unter den Fingern zerfallen würde. War der Vater ein gut aussehender, groß gewachsener Guerillero gewesen, der mit koreanischen Proletariern ebenso gut konnte wie mit afrikanischen Königen in Löwenpelzkrägen, so hatte wenig davon auf den Sprössling abgefärbt: Kim Jong-il meidet die Öffentlichkeit, reist aus Angst vor dem Fliegen nur im Zug, war nie beim Militär. Er trägt Plateauschuhe, fönt die Haare zum Himmel und weist seine Hoffotografen an, ihn von unten zu fotografieren, damit er auf den Bildern größer erscheint.
Republikflüchtlinge erzählen, dass im Volk die grenzenlose Verehrung für den Vater echt, die für den Sohn aber geheuchelt sei. Deswegen muss Kim Il-sung weiterleben, als "ewiger Präsident". Kim Jong-il benutzt die konfuzianische Tradition Koreas: Treue zum Herrscher und Verehrung der Ahnen sind seit Jahrhunderten ins Bewusstsein der Menschen eingewebt. Sein Vater ist der Vater aller Koreaner. Nur die Ältesten können sich noch an ein Leben vor Kim Il-sung erinnern, alle anderen sind mit Seinem Bildnis aufgewachsen: In der Kinderkrippe ist Er es, der ihnen die Spielsachen schenkt; Ihm danken sie vor dem Essen für das bisschen Reis. Er beschützt sie vor den Monstern, die ihre Bilderbücher bevölkern, langhaarigen Japanern, amerikanischen Werwölfen.
Kim Jong-il liebt das Kino
Die Filmbibliothek des Diktators, ein dreistöckiges Gebäude mit 250 Angestellten, umfasst 15 000 Filme - die meisten davon im Land streng indiziert. Seit Jahrzehnten dirigiert Kim Jongil die Staatliche Filmindustrie. Anfangs, als deren gehirngewaschene Regisseure keine guten Filme zustande brachten, saß er nachts selbst im Schneideraum. Schließlich ließ er den bekanntesten Regisseur Südkoreas nach Pjöngjang entführen, steckte ihn erst für fünf Jahre in ein Arbeitslager und dann in ein marmorgetäfeltes Büro. Schon in den 1960er Jahren betrieb Kim Jong-il, noch keine 30 Jahre alt, die koreanische Kulturrevolution, um sich die Bilder untertan zu machen. Er ließ alle abstrakte Kunst aus dem Land verbannen, gründete ein Literarisches Institut, eine Filmschule und eine Kunstakademie. Einziger Zweck der drei Akademien: die Darstellung des Großen Führers zu perfektionieren.
Die Armee frisst das Land auf
700 000 nordkoreanische Soldaten bewachen angeblich die Grenze; nachts leuchten die Taschenlampen ihrer Patrouillengänger in den Hügeln wie ein Schwarm Glühwürmchen in einer Sommerwiese. Mehr als 10 000 Geschützrohre sollen auf Südkoreas Kapitale Seoul gerichtet sein, bereit, die Millionenstadt in "ein Meer aus Feuer" zu verwandeln, wie ein nordkoreanischer Diplomat 1994 gedroht hat. In der Staatsdoktrin der Demokratischen Volksrepublik Korea nimmt das Militär den ersten Rang ein, noch vor der Arbeiterklasse. Mehr als eine Million Soldaten formen die fünftgrößte Armee der Welt; ihr Unterhalt frisst die Wirtschaft auf.
"Wir gehen durch schwere Zeiten", brummt Kang Ho-sop, "aber wir bitten niemanden um Hilfe." Die Bauern an der Grenze füttern die Soldaten mit Mais durch, wenn die Rationen knapp werden. Tausende leben im Grenzstreifen, Kinder baden im Fluss, kann Kang Ho-sop sie beschützen? "Wir haben genug Kraft, um Krieg mit Krieg zu beantworten." Er hat eine vierjährige Enkelin; sie soll einmal Soldatin werden. Oder Schriftstellerin, wenn das Land erst wiedervereinigt ist.
Aber wer würde das wiedervereinigte Korea regieren? Eine sozialistische oder eine kapitalistische Führung? "Wir wollen eine Föderation beider Staaten. Dann werden wir sehen, welches System sich durchsetzt." Die Entscheidung darüber ist längst gefallen. Auch wenn die Führung der Volksrepublik sogar auf Importmaschinen in ihren Fabriken koreanische Typenschilder klebt, um den Eindruck zu erwecken, sie seien koreanischer Bauart, und so Autokratie suggeriert, sickert in Wahrheit der Kapitalismus durch alle Ritzen des maroden Bollwerks, das zu einem der ärmsten Länder der Welt geworden ist. Das staatliche Versorgungssystem, in der Hungersnot Ende der 1990er Jahre zusammengebrochen, erreicht nur einen Teil der Hilfsbedürftigen.
Eine Bratente kostet einen Monatslohn
Überall im Land sehen wir Verkaufsstände, die wir unter keinen Umständen fotografieren dürfen, wie unsere Begleiter in panischer Angst fordern. Auf einem Parkplatz bietet uns eine Familie geröstete Nüsse an, so verstohlen, als wären es Waffen. Mitarbeiter einer Hilfsorganisation auf dem Land erzählen uns, alle zehn Tage ruhe die Arbeit, denn dann sei Markttag. Auf den Märkten würden 80 Prozent aller Güter des täglichen Bedarfs umgesetzt. Wir bekommen einen solchen Markt in Pjöngjang zu sehen, erleben 2400 adrett gekleidete Verkäuferinnen in einer Halle. Alle arbeiten auf eigene Rechnung, von Scheu und Zurückhaltung ist nichts zu spüren: Hier werden Geschäfte gemacht. Die Frauen seien allesamt Hausfrauen, die verkauften, was immer sie in ihren Haushalten übrig hätten, erklärt uns die Marktleiterin treuherzig. Wir sind beeindruckt, was in nordkoreanischen Wohnungen alles erübrigt werden kann: fabrikneue DVD-Player, Rallye-Lenkräder für Toyota-Geländewagen, Yamaha-Pianos, palettenweise schottischer Whisky. Und Lebensmittel: Melonen, Tomaten, getrockneter Fisch, schlachtfrisches Hundefleisch im Überfluss.
Wir sehen eine Bäuerin, die Enten und ein zerlegtes Schwein verkauft. Sie verdient damit 210 000 koreanische Won im Monat, 70 Euro. Die Waren auf dem Markt sind für die meisten Menschen im Land jedoch unerreichbar: Eine Näherin verdient einen Euro, ein Minenarbeiter fünf Euro im Monat. Falls die Löhne überhaupt bezahlt werden, was in den vergangenen Jahren nur noch unregelmäßig der Fall gewesen sein soll. "Kim Jong-il ist bankrott. Das Regime lebt von der Hand in den Mund", sagt der westliche Diplomat mit gedämpfter Stimme, wir sitzen im Partykeller des Welternährungsprogramms, vor Jahren als Kontaktbörse für jene Ausländer eingerichtet, die in Pjöngjang arbeiten. Seit das Regime im Herbst 2005 die meisten Hilfsorganisationen des Landes verwiesen hat, ist es einsam geworden in Pjöngjangs Fremdenghetto. Weniger als 100 Ausländer leben im Land.
Der Diplomat trägt Sandalen, Shorts, ein T-Shirt und will anonym bleiben. "Die Militärs gewinnen wieder an Einfluss. Reformen werden Stück für Stück zurückgenommen. Kim Jong-il rettet sich von einem Tag zum nächsten. Und sei es mit Geldfälschung und Drogenschmuggel." Warum sind die Reformen gescheitert? "Sie finden keinen Weg, die Marktwirtschaft mit der Philosophie Kim Il-sungs in Übereinstimmung zu bringen. Der innerste Zirkel der Macht zerfleischt sich in mönchischen Diskussionen darüber, wie Seine Worte auszulegen sind." Gott hat sein Volk in die Wüste geführt und es angewiesen, im Kreis zu gehen.
Ein schwarzes Loch
Als wir spät nachts zurück ins Hotel gefahren werden, passieren wir am Ufer des Taedonggang das Nachtlager eines Bataillons. Hunderte Soldaten scharen sich um Lagerfeuer. Sonst ist niemand unterwegs. Dunkelheit hat die Boulevards verschluckt. Auf nächtlichen Satellitenfotos, auf denen die bewohnte Welt einem Netz aus Myriaden strahlender Galaxien gleicht, erscheint Nordkorea als Schwarzes Loch. Etwa zur gleichen Nachtzeit herrscht noch immer dichter Verkehr in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas. Bildschirme flackern auf den Dächern der Hochhäuser, junge Leute sitzen im Park und schauen auf ihren Mobiltelefonen fern, flirten elektronisch. Die Entfernung zwischen Pjöngjang und Seoul beträgt 200 Kilometer, oder ein halbes Jahrhundert.
Nur wenigen gelingt die Flucht
Lee Dong-su hat neun Stunden gebraucht für die Reise. Nur wenige Nordkoreaner wagen es, direkt in den Süden zu fliehen, die Grenze gilt als unpassierbar. Die meisten nehmen einen Umweg über China und Thailand; doch der ist lang, gefährlich und teuer. Lee Dong-su stahl ein Boot und kam übers Meer, das ist fünf Monate her. Wir sind an einem belebten Platz verabredet. Lee Dong-su lässt mich stundenlang warten, schließlich taucht er auf, die Dolmetscherin erschrickt, als neben ihr plötzlich ein Mann steht und grußlos zu sprechen beginnt. Der 37-Jährige trägt sein Haar wie Elvis Presley, ein Streifenhemd mit türkisfarbenen Kragensteinen. Und eine verspiegelte Sonnenbrille mit weißem Plastikgestell. Kein Südkoreaner würde ihn für einen der ihren halten.
"Arbeiten Sie für die Regierung?", schnauzt er die Dolmetscherin an und schaut sich argwöhnisch um. "Haben Sie dieselben Vorurteile gegen Nordkoreaner wie alle hier?" Lee Dong-su wurde erst wenige Wochen zuvor aus Hanawon entlassen, dem Umerziehungslager der Südkoreaner. Alle Flüchtlinge aus dem Norden - seit 1953 kamen 8000, davon 5000 in den vergangenen fünf Jahren - müssen nach ihrer Ankunft nach Hanawon. Dort werden sie zuerst vom südkoreanischen Geheimdienst verhört, dann erhalten sie Unterricht in Grundlagen der Demokratie. Aber Lee Dong-su will nicht ankommen, jedenfalls nicht so, wie es seine südkoreanischen Betreuer gern hätten. Er will nicht dankbar sein. "Ich bin nicht wegen des Geldes gekommen", sagt er bitter, "ich bin kein Hungerflüchtling. Ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, um hier für die Vereinigung Koreas zu arbeiten."
"Nur die Härtesten haben überlebt"
Die Nahrungskrise im Norden sei überwunden, sagt er, weil die Menschen gelernt hätten, alles zu Geld zu machen, und: "Nur die Härtesten haben überlebt." Nein, es gebe keine Arbeitslosigkeit, wer keine Arbeit habe, werde zum Arbeitsdienst herangezogen. Der Unmut in der Bevölkerung sei groß, aber nur aus wirtschaftlichen Gründen. Wann hat sich dieser Unmut entzündet?
"Nach dem Tod Kim Il-sungs." Er kann seinen Namen nicht aussprechen, ohne den Kopf und die Stimme zu senken, danach schießt er Seitenblicke nach links und rechts. Es ist, als hätte er die Anstecknadel mit dem Konterfei des Großen Führers nie abgelegt. Über die Details seiner Flucht will Lee Dong-su nicht reden, erst recht nicht über Todesstrafe und Arbeitslager. Stattdessen verfasst er auf einem Blatt Papier eine Erklärung, in der er sich als koreanischen Patrioten bezeichnet. Dann bricht er das Interview ab.
Eine Woche nach unserem Interview meldet die südkoreanische Menschenrechtsorganisation "Citizen's Alliance", dass es ihr gelungen sei, einen Kundschafter in Lee Dong-sus Heimatstadt zu schicken. Von den 22 Mitgliedern seiner Familie, meldete der Agent, seien 19 verschwunden.