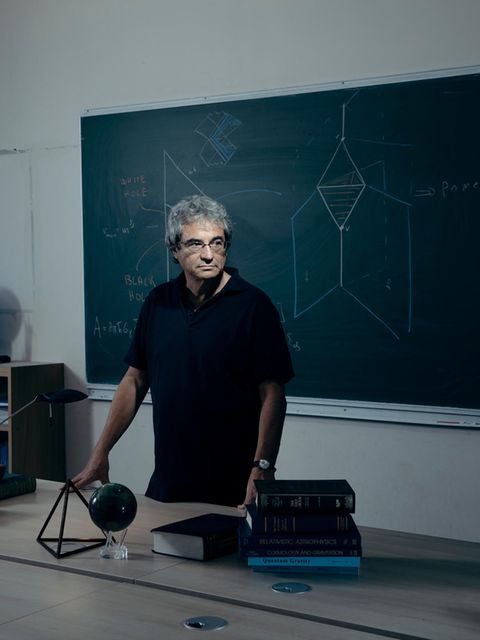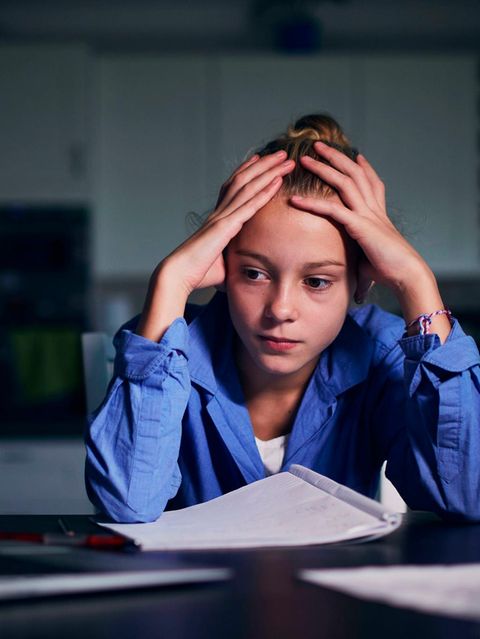Tiblets Oeleta würde am liebsten schreien, doch sie hält sich die Hand vor den Mund. Tsadu ist verschwunden. Der Strick, mit dem die Eselin festgebunden war, liegt am Boden. Ein Unwetter in der Nacht hat das Tier erschreckt. Blechdosen waren umhergewirbelt. Der Sturm hat das Dach vom Stall gefegt und den Mais im Garten niedergewalzt. Es ist Mahar, Regenzeit. Tiblets Oeleta rafft den Rock und läuft los, vorbei am Lehmbackofen, hinaus durch das Gartentor aus Autoreifen, hinein in die mit zartgrünem Gras bedeckte Savanne, die hinter dem Dorf Fithi im Tiefland Eritreas beginnt. In manchen Nächten schleichen Hyänen und Leoparden um die Hütten.
MP3-Download
Die Eselin ist das Wertvollste, das Tiblets Oeleta je besessen hat. Sie ist ihre Lebensversicherung, ihre Zukunft. Wenn Tsadu etwas passiert, dann wäre alles wieder wie früher. Hunger, Durst. Striemen an Brust und Schultern, Brandzeichen, die noch vor vier Jahren jedem verrieten, dass Tiblets ihr Wasser täglich vom Fluss ins Dorf schleppen musste. Kilometerweit trug sie den gelben 20-Liter-Kanister, am Körper festgezurrt mit einem Strick, auf dem Rücken durch Hitze und Staub.
Ein Eselfohlen bringt die Wende
Doch inzwischen kommt es der 48-Jährigen so vor, als wäre nicht sie diese ausgemergelte Person gewesen. Sondern eine fremde Frau, die von ihrem Mann verlassen worden war. Die in der Dämmerung bei Nachbarinnen um Hirse betteln ging und die Hand voll Körner, die sie ihr gaben, zwischen Steinen zu Mehl mahlte. Einen faden Klumpen Hirsebrei – mehr konnte sie ihren Kindern, zwei Jungen, drei Mädchen, oft nicht geben. Und dann stand Tsadu vor ihr. Ein Eselfohlen, das sie geschenkt bekommen hatte. Das die Ohren anlegte und an ihrem Rock zupfte. Es war so genügsam, dass das magere Gras der Savanne ausreichte, um es groß werden zu lassen.
Nach einem Jahr bekam Tsadu ihr erstes Junges. Tiblets verkaufte es auf dem Markt. Von dem Geld erstand sie zwei Ziegen, deren Milch sie im Dorf anbot. Von dem Gewinn erwarb sie zwei Hühner. Tsadu schleppte vier Wasserkanister gleichzeitig vom Fluss nach Hause. Tiblets verkauf- te einen Teil des Wassers, mit dem Rest zog sie im Garten Guaven, Kürbisse, Bohnen, Zucchini; die Kinder aßen wieder drei Mahlzeiten am Tag. Tiblets pachtete Ackerland, auf dem sie nun Hirse anbaut, in guten Jahren erntet sie mehr, als sie zum Überleben braucht. Früher verdiente Tiblets höchstens zwei Nakfa am Tag, umgerechnet zehn Cent; nun sind es 50 Nakfa, manchmal sogar 100. Aus der ausgemergelten Bettlerin ist eine Geschäftsfrau geworden.
Eines der ärmsten Länder der Welt
Eritrea zählt zu den zehn ärmsten Ländern der Welt. Nach Schätzungen der UN ist in dem immer wieder von Dürren heimgesuchten Land am Horn von Afrika rund die Hälfte der vier Millionen Einwohner von Nahrungsmittelhilfen abhängig. Fast jedes zweite Kleinkind leidet an Untergewicht; jedes zehnte stirbt, bevor es fünf Jahre alt wird. Im Durchschnitt bringt eine eritreische Frau mehr als fünf Kinder zur Welt; und jede dritte muss, wie Tiblets Oeleta, ihre Familie ohne die Hilfe eines Mannes am Leben erhalten. Denn die Scheidungsrate ist hoch für ein Land, in dem die Hälfte der Bevölkerung islamischen Glaubens ist, die andere dem orthodoxen Christentum anhängt. Zudem sind viele Väter in einem 30 Jahre währenden Krieg gegen Äthiopien gefallen. Er ist erst 1993 zu Ende gegangen und fünf Jahre später noch einmal ausgebrochen. Und immer noch herrscht kein wahrer Friede, schwelt ein Grenzkonflikt mit dem Nachbarn.
Frauen als Soldatinnen
Auch Frauen sind in den Krieg gezogen, um ihr Land, das lange italienische, dann britische Kolonie war, vor einer Annektion durch Äthiopien zu bewahren. Frauen wie Tsion Ocbamichael. Die drahtige 54-Jährige ist Chefin der Abteilung Soziales und Gesundheit der eritreischen Frauenunion „Hamade“, die 1979 von Soldatinnen gegründet wurde. In ihrem Büro in Barentu, Hauptstadt der westlichsten Provinz des Landes, erklärt Ocbamichael die Ziele der Hamade, deren Symbol ein Frauenkopf ist, über dem zwei Hände ineinandergreifen. Der Ausnahmezustand, Zerstörung und Entbehrung, sagt Ocbamichael, hätten Mann und Frau während des Krieges ebenbürtig gemacht. „Wir lebten in enger Gemeinschaft, trugen die gleichen Kurzhaarschnitte, Khakihosen, Sandalen aus Autoreifen. Die Frauen reparierten Lastwagen, trugen Waffen und standen an der Front. Und auch die Männer wuschen Wäsche, sammelten Pflanzen und kochten Gemüse.“
Nach dem Krieg aber habe sich wieder das alte Geschlechterverhältnis etabliert. „Wie die Tradition es wollte.“ Die Männer schickten ihre Kameradinnen zurück zum Brotbacken, zum Körbeflechten, zum Wasserholen. Unter das züchtige Kopftuch. In die Armut.
Tsion Ocbamichael, die erst im Militärcamp Lesen und Schreiben gelernt hat, ist an weite Hosen und Hemden gewöhnt – und daran, mit Männern an einem Tisch zu sitzen, ihre Meinung zu sagen, eigenes Geld zu verdienen. Doch was, fragte sie sich mit ihren Mitstreiterinnen von der Hamade, würde auch den Frauen in den Dörfern, den alleinstehenden Müttern, den Kriegswitwen Einkommen und Respekt verschaffen? Ihre Antwort: Esel!
Ein Esel kostet umgerechnet 110 Euro
Seit 1995 hat die Hamade 5500 Esel an eritreische Frauen verschenkt. Genügsame Tiere, wie geschaffen zum Geldverdienen. Ein Esel kostet rund 2200 Nakfa, 110 Euro. Eine Summe, für die eine alleinerziehende Frau ihr Leben lang sparen müsste. Manchmal sitzt Tiblets Oeleta in der Dämmerung auf der kleinen Lehmbank vor ihrer Lehmhütte, schaut den Fledermäusen nach und lässt ihre Gedanken schweifen – der Luxus ihres neuen Lebens. Verschwunden sind die Müdigkeit, die Striemen an Schultern und Brust, die Scham vor den Nachbarn, das niederdrückende Gefühl, dem Leben ausgeliefert zu sein.
Sie ist stolz auf das, was sie geschafft hat: Auf die Hütte mit den weiß getünchten Wänden, den Madonnenbildern und den gerahmten Familienfotos. Zwei große Eisenbetten mit Blümchenlaken stehen nun da, wo früher Bastmatten auf dem Boden lagen. Ihr Hausrat stapelt sich auf einem Tisch. Ein Wohlstand, den sie ohne Mann geschaffen hat. Wenn Tiblits erzählt, hält sie das Kopftuch nicht, wie die anderen Frauen, vor das Gesicht, sondern schiebt es sich mit einer entschiedenen Geste hinter die Ohren. „Als ich 13 Jahre alt war, verschacherte mich mein Vater an einen Wildfremden. Er war 24 Jahre älter als ich. Ich habe mich nie an ihn gewöhnt. Als ich mit meinem Jüngsten schwanger war, hat er mich verlassen.“
"Warum müssen Mädchen mit 13 heiraten?" So sollte es ihren Töchtern nicht ergehen, und deswegen hat die neue Tiblets Fragen gestellt, die eine Frau im Dorf nicht fragt: Warum müssen Mädchen im Alter von 13 Jahren heiraten? Warum einen Mann, den sie nicht kennen? Warum bekommen Mädchen so früh Kinder – während die Jungen Lesen und Schreiben lernen?
Unternehmergeist ist wichtig
Wenn Tsion Ocbamichael mit dem Jeep aufs Land hinausfährt, sagt sie den Frauen, die sich um einen Esel bewerben: „Ihr braucht Geschäftsideen, auf die in euren Dörfern noch niemand gekommen ist!“ Wie Netseti. Die 26-jährige Witwe sammelt mit ihrem Esel Holz, um Ofenplatten aus Ton zu brennen. Oder wie Amna. Sie transportiert mit ihrem Lasttier Sand zu Baustellen. Hiwet versorgt ein Mönchskloster auf einer Bergkuppe mit Wasser. Und dann ist da noch Khadija, die Hebamme. Analphabetin, wie fast die Hälfte aller Eritreerin- nen. Manchmal lässt sie sich von ihrer Tochter aus einem Buch über Geburtshilfe vorlesen. Das ist, wie ihr Esel, ein Geschenk der Hamade. Khadija bewahrt es sorgfältig in ihrem Hebammenköfferchen auf.
Berittene Hebammen sind mobiler
Die wichtigsten Kapitel des Lehrbuchs hat sie Wort für Wort auswendig gelernt. In der Nacht zuvor hat sie Fatna, einer jungen Frau, bei der Geburt ihres ersten Kindes beigestanden. Gemeinsam haben sie auf dem gestampften Lehmboden der Hütte gehockt, Khadija hat der werdenden Mutter den Rücken gestützt und ihr immer wieder beruhigende Worte zugemurmelt. Ungewohnt fühlten sich die Plastikhandschuhe an, die Khadija zum ersten Mal trug. Doch auch das hat die Hebamme bei einem Geburtshilfekurs der Frauenorganisation gelernt: Die Entbindungen in den Hütten müssen sauberer und damit sicherer werden. Nach neun Stunden kam schließlich ein Junge zur Welt, der vom Vater lang ersehnte. Khadija hat die gute Nachricht in die Dunkelheit hinausgerufen, gefolgt von sieben Trillern, die den Dorfbewohnern verkündeten, dass Mutter und Kind wohlauf sind.
Auf dem Land stirbt jede zehnte Gebärende. Ärzte gibt es in den Dörfern nicht. Die Hebammen sind oft drei, vier, fünf Stunden zu Fuß unterwegs, um die Häuser der Frauen zu erreichen. Und nicht selten kommen sie dabei zu spät. Deshalb ist Khadija glücklich, dass sie seit einem halben Jahr einen Esel besitzt. Und mindestens einmal hat er auch schon ein Leben gerettet: Als Khadija eine Schwangere untersuchte und plötzlich im Bauch der Frau keine Bewegung mehr fühlte, keinen Herzschlag mehr hörte. Eigentlich ist Khadija eine fröhliche Frau; beim Sprechen gestikuliert sie gern und lässt ihre Armreifen klirren, aber wenn sie sich an jenen Schreckensmoment erinnert, hält ihre linke Hand die rechte fest. „Ohne den Esel hätte ich die Mutter niemals rechtzeitig nach Barentu ins Krankenhaus bringen können.“
Wider die Beschneidung der Frauen
Kein Strom, keine Straße. Nur Trampelpfade verbinden die eingezäunten Gehöfte aus Lehm und Stroh, in denen meist mehrere Generationen zusammenleben – der Alltag in Shilabo, Khadijas Dorf. Er ist einer einfachen Regel unterworfen, und die lautet: „Das war schon immer so!“ So reden sie, die Alten; misstrauisch gegen alles Neue und stur, auch wenn es um grausame Bräuche geht. Seit Jahren kämpft die Hamade gegen weibliche Genitalverstümmelung. Laut eritreischer Verfassung ist sie verboten; aber die Verfassung ist nicht in Kraft. 89 Prozent aller eritreischen Frauen sind beschnitten. Viele von ihnen wissen nicht einmal, dass die Schmerzen, die sie seit ihrer Kindheit ertragen, genau darauf zurückzuführen sind.
Es sind meist die Hebammen, die zum Messer greifen und mit dieser Sitte, die Mädchen rein und Ehefrauen treu machen soll, Geld verdienen. Die Esel sind für die Hamade eine Chance, Aufklärungs- Politik zu betreiben. „Nur wer sich als Hebamme verpflichtet, gegen die Beschneidung zu kämpfen, bekommt einen Esel von uns geschenkt“, sagt Tsion Ocbamichael. Und so hat auch Khadija mit dem archaischen Ritus gebrochen; ist sich des Leidens jener Frauen bewusst geworden, denen oft nur eine Öffnung von der Größe eines Maiskorns für Urinabfluss und Monatsblutung gelassen wird. Sie weiß, dass es lebensgefährlich ist, wenn „zugenähte“ Bräute in der Hochzeitsnacht mit dem Messer ein Stück weit „geöffnet“ werden. Sie bangt mit den Müttern um ihre Babys, die während der Geburt zu ersticken drohen.
„Ich vergebe meinen Urahnen, dass sie ihre Töchter verstümmelt haben“, sagt Khadija. „Aber wir leben im 21. Jahrhundert, wir wissen es doch besser.“ Und das flüstert sie nun den Schwangeren, den jungen Müttern zu, wiederholt es wie eine Formel, beharrlich, aber sanft: Erspart den Mädchen diese Marter.
Die Frauen von Gulul haben die Hand gehoben und für Aifa Andu gestimmt: 29 Jahre alt, Mutter einer kleinen Tochter. Sie soll die nächste sein, die einen Esel bekommt. „Weil sie nicht einmal ein Huhn besitzt!“, rufen sie. „Und weil sie und ihre Tochter so mager sind wie Grillen!“
Esel für Eritrea
„Haben Sie denn keinen Esel?“, fragte Stefanie Christmann, als sie 1994 für eine wissenschaftliche Studie in Eritrea recherchierte und viele Frauen schwere Lasten tragen sah. „Der Esel sind wir selbst!“, war die Antwort. Zurück in Deutschland, begann die heute 46-jährige Mitarbeiterin des Berliner Umweltministeriums Spenden für Lasttiere zu sammeln und sie an die eritreische Frauenunion (NUEW) zu überweisen. Deren Mitglieder (einige von ihnen im Bild oben) organisieren die Vergabe der Esel in den Dörfern. Jedes Jahr reist Christmann auf eigene Kosten an das Horn von Afrika, um den Fortgang des Hilfsprojekts zu verfolgen. Binnen elf Jahren sind dank der Gelder aus Deutschland 5500 Esel an alleinstehende Mütter und an Hebammen verschenkt worden. Dafür hat Stefanie Christmann im Oktober 2006 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Nähere Informationen zur Spendenorganisation finden Sie unter: www.esel-initiative.de