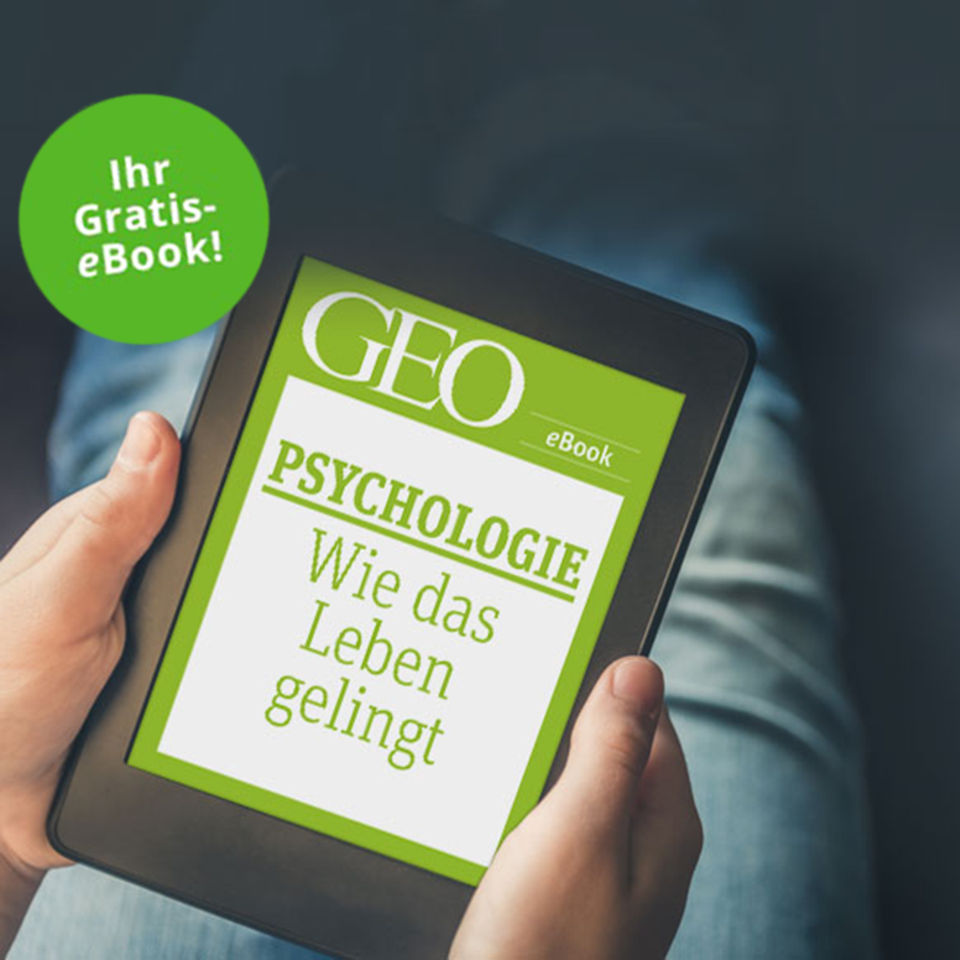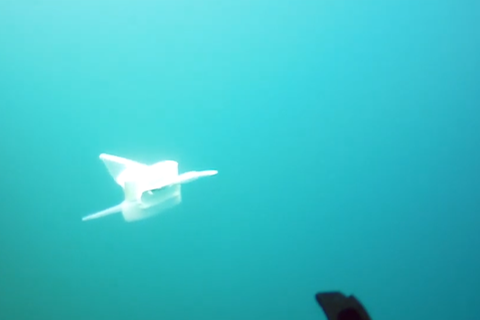Niemand kann sich sein Geschlecht aussuchen: Wir wachsen mit unserer sexuellen Identität auf und allen Vor- oder Nachteilen, die diese Rolle für den Lebensweg mitbringen mag. Und doch hat wohl jeder schon darüber nachgedacht, wie es wäre, die Welt aus den Augen des anderen Geschlechts zu betrachten: Würden wir dann anders empfinden, Menschen, Situationen und Handlungen anders bewerten? Denn immer noch gibt es das Klischee, nach dem Männer technikvernarrt sind, durchsetzungsstark – aber unfähig, ihre Gefühle zu benennen. Wogegen Frauen angeblich gut vermitteln können, aber keinen Sinn für Orientierung haben und sich schwertun, Entscheidungen zu fällen.
Viele Menschen glauben, solchen Zerrbildern lägen reale Unterschiede zugrunde – schließlich formen Chromosomen und Hormone unsere Körper ja in der Regel typisch männlich oder weiblich. Wie sollte dies nicht auch das Denken, Fühlen und Verhalten der jeweiligen Geschlechter beeinflussen? Doch empfinden Männer und Frauen tatsächlich unterschiedlich? Wie groß sind die Differenzen in Fragen der Persönlichkeit, in den Fähigkeiten, Einstellungen, Interessen wirklich? Und wenn es Unterschiede gibt – sind die im Gehirn verortet? Von Hormonen gesteuert? Oder in den Genen verankert? Und legen sie uns bestimmte Wege durch unsere Leben nahe?
Faktoren der Wesensprägung sind hochkomplex
Es ist außerordentlich schwierig, diese Fragen eindeutig zu beantworten – zu komplex sind die Faktoren, die unser Wesen prägen, zu hartnäckig scheinen sich bestimmte Überzeugungen und Prämissen in dieser Debatte zu halten. Daher wird auch unter Forschern darüber gestritten, ob Geschlechterdifferenzen angeboren oder anerzogen sind, erlernt oder evolutionäres Erbe. Manche sehen die Unterschiede als eher sozial konstruiert, andere als biologisch programmiert.
Doch trotz dieser unterschiedlichen Blickwinkel haben Forscher in den letzten Jahren zu drei wesentlichen Aspekten des maskulinen und femininen Andersseins wegweisende Erkenntnisse gewinnen können:
I. Gehirn: Wie unterscheiden sich die Geschlechter im Denkorgan?
II. Hormone: Welchen Einfluss haben Östrogen und Testosteron?
III. Verhalten: Gibt es typisch männliche/weibliche Eigenschaften?
Um diese Fragen präziser zu klären, haben die Experten zahllose Gehirnscans, Tests, Experimente und Fragebögen ausgewertet. Was sie gefunden haben, mag überraschen: Es deutet zum einen darauf hin, dass sich geschlechtsspezifische Trennlinien längst nicht so klar ziehen lassen wie lange gedacht. Und zum anderen könnten bereits winzige biologische Nuancen große Auswirkungen haben.
I. Wie unterscheiden sich die Gehirne von Mann und Frau?
Weshalb es Frauen mit typisch männlichen Hirnstrukturen gibt – und Männer mit typisch weiblichen
Viele Menschen gehen davon aus, dass sich geschlechtstypische Verhaltensweisen und Vorlieben in Strukturen des Denkorgans widerspiegeln. Für sie ist klar: Es gibt ein Frauenhirn und ein Männerhirn. Tatsächlich sind die Gehirne von Männern nicht zuletzt schon aufgrund von deren rein statistisch betrachtet größerer Körpermasse im Schnitt gut zehn Prozent voluminöser und gut 100 Gramm schwerer. Und auch unabhängig vom Einfluss der Gesamtgröße zeigt sich in bestimmten Bereichen ein unterschiedliches Volumen – zum Beispiel im Hippocampus, einer Gehirnregion, die an Erinnerungsvermögen und Lernen, aber auch an der Steuerung von Affekten beteiligt ist. Oder im Nucleus caudatus, dem Schweifkern, der mitverantwortlich komplexe Bewegungsabläufe kontrolliert.
Gehirne sind nicht typisch männlich oder weiblich
Inzwischen ist jedoch klar: In den meisten Fällen ergibt es wenig Sinn, ein Gehirn anhand derartiger anatomischer Auffälligkeiten als typisch männlich oder typisch weiblich zu kategorisieren. Ein internationales Team von Neurowissenschaftlern hat anhand von Kernspintomografie-Aufnahmen die Gehirne von mehr als 1400 Personen im Alter zwischen 13 und 85 Jahren analysiert und sich dabei auf die Hirnregionen mit den größten geschlechtsspezifischen Unterschieden konzentriert. Doch auch in diesen Bereichen fanden die Forscher noch starke Überschneidungen zwischen den Geschlechtern: Zwar war der linke Hippocampus bei Männern meist größer als bei Frauen. Aber gleichzeitig gab es Frauen, die einen eher großen linken Hippocampus aufwiesen – und Männer, deren Hippocampus kleiner war als der einer Durchschnittsfrau.
Um diese Überlappungen darzustellen, haben die Forscher ein Spektrum von Merkmalen für das gesamte Gehirn entworfen: An dem einen Ende dieses Spektrums hielten sie jene Merkmale fest, die eher typisch für männliche Gehirne waren, an dem anderen Ende jene, die häufiger bei Frauen zu beobachten waren. Danach bewertete das Team jedes einzelne in der Studie untersuchte Gehirn Region für Region, um es entsprechend auf dem Spektrum zu verorten.
Das Gehirn formt das Verhalten – und das Verhalten formt das Gehirn
Das Ergebnis: Das gleiche Gehirn kann in einem Bereich am weiblichen und in einem anderen Bereich am männlichen Ende des Spektrums liegen. Ein typisch weibliches Merkmal sagt nichts darüber aus, ob auch andere Hirnregionen weiblich geprägt sind. Nur sechs Prozent der Gehirne zeigten allein typisch weibliche oder männliche Strukturen. Die überwiegende Mehrheit der untersuchten Denkorgane wies eine Mischung aus männlichen und weiblichen Merkmalen auf. Das Geschlecht hat also einen Einfluss auf die Struktur und Funktionsweise des Gehirns – aber jedes einzelne Gehirn ist ein Mosaik.
Ob und wie diese Unterschiede in den Strukturen mit dem Verhalten zusammenhängen, ist nicht hinreichend geklärt. Denn das Gehirn formt das Verhalten – und das Verhalten formt das Gehirn. Vor allem Erfahrungen, die wir wiederholt machen, können das Denkorgan nachhaltig prägen. Alltägliche Anforderungen sorgen dafür, dass sich unser Gehirn dem Bedarf anpasst, ganz individuell. Möglich wäre es also auch, dass unterschiedliche Alltagserfahrungen von Männern und Frauen ihre Gehirne geschlechtsspezifisch formen und dazu führen, dass sie sich je nach Geschlecht unterschiedlich verhalten. Aber es gibt einen dritten Faktor in dieser Wechselbeziehung: die Hormone.
II. Welchen Einfluss haben Botenstoffe auf Denken und Fühlen?
Wieso Frauen ängstlicher und Männer impulsiver sind – und wann sich dieses Verhältnis umkehrt
Beide Geschlechter produzieren sowohl männertypische Hormone wie Testosteron als auch frauentypische wie Östrogen und Progesteron – allerdings in unterschiedlichen Konzentrationen: Die Menge an Testosteron im Körper eines Mannes ist im Mittel zehnmal so hoch wie die im Körper einer Frau. Der Hormonspiegel beeinflusst Eigenschaften, Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale wie beispielsweise die Extraversion oder auch die mütterliche Fürsorge. Er entscheidet mit darüber, wie impulsiv ein Mensch handelt, wie viel Vertrauen er in andere und in sich selbst hat, wie er Gefühle empfindet und verarbeitet.
Experimente zeigten: Wenig Testosteron macht sensibel und empfindungsstark
In einem Experiment zeigten Forscher der Universität Montreal 25 Frauen und 21 Männern diverse Bilder: amüsante, furchteinflößende, traurige. Die Teilnehmer sollten ihre Gefühle beim Anblick der Bilder beschreiben, gleichzeitig untersuchten die Forscher ihre Hirnaktivität per Magnetresonanztomografie und analysierten ihre Hormonspiegel im Blut. Das Ergebnis: Frauen empfanden die negativen Emotionen stärker – und je niedriger ihr Testosteronspiegel war, desto sensibler reagierten sie.
In den Gehirnen beider Geschlechter waren beim Betrachten der Bilder zwei Gehirnbereiche besonders aktiv:
- die Amygdala, das Gefühlszentrum des Gehirns, das emotionale und insbesondere potenziell bedrohliche Reize bewertet und daher oft auch als Angstzentrum bezeichnet wird;
- und der präfrontale Kortex, das rationale Kontrollzentrum direkt hinter der Stirn, das Signale mit bereits im Gedächtnis gespeicherten Eindrücken und Erfahrungen abgleicht, die zur Situation passenden Handlungen plant und emotionale Reize reguliert.
Frauen zeigen eine schwächere Verknüpfung von Gefühls- und Kontrollzentrum
Je höher der Testosteronspiegel der Probanden war, umso stärker waren diese beiden Areale in ihrem Gehirn verknüpft. Frauen haben im Schnitt einen niedrigeren Testosteronlevel, sie zeigten daher eine schwächere Verknüpfung von Gefühls- und Kontrollzentrum – und reagierten stärker auf negative Reize. Das könnte möglicherweise erklären, so schlossen die Forscher, weshalb Frauen beispielsweise doppelt so häufig an Depressionen und Angststörungen leiden wie Männer. Individuell ist die Zusammensetzung der Hormonmischung allerdings sehr unterschiedlich – und vor allem: Sie verändert sich im Lauf der Zeit.
Kein Gehirn ist ein Leben lang dem immer gleichen Hormoncocktail ausgesetzt. Je nach Tages- und vermutlich zudem je nach Jahreszeit unterliegt auch der Hormonspiegel von Männern starken Schwankungen. Bei Frauen verändert sich die Konzentration der Botenstoffe im Blut im Laufe des Menstruationszyklus sowie mit dem Einsetzen einer Schwangerschaft oder der Menopause. Mit enormer Wirkung: Studien zeigen, dass die Hormonflut während einer Schwangerschaft das Gehirn in bestimmten Bereichen regelrecht umgestaltet. Mehr noch: Auch die subtileren hormonellen Schwankungen im Monatsrhythmus der Menstruation verändern regelmäßig die Hirnstruktur. Parallel zum ansteigenden Östrogenspiegel bis zum Eisprung nimmt beispielsweise das Volumen des Hippocampus zu.
Soziale Faktoren haben Einfluss auf biologische Vorgänge im Körper
Möglicherweise wirkt sich der Hormonspiegel nicht nur auf Emotionen und Verhalten aus, sondern auch auf kognitive Leistungen. Während ihrer Menstruation, wenn der Östrogenspiegel niedrig ist, zeigen Frauen beispielsweise ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen.Umgekehrt können Verhalten und Erfahrungen die Hormonaktivität beeinflussen – etwa die Konfrontation mit Geschlechterklischees. Bei einem Experiment sollten männliche und weibliche Teilnehmer Aufgaben zum räumlichen Denken lösen. In einem der beiden Männerteams wurde zuvor darüber gesprochen, dass diese Fähigkeit im Durchschnitt bei Männern stärker ausgeprägt ist als bei Frauen.
Die Folge: Bei diesen Probanden lag der Testosteronspiegel um 60 Prozent höher als in der Kontrollgruppe. Schon die Erwartung also, allein aufgrund ihres Geschlechts bei dem Test besser abzuschneiden, hatte offenbar das Selbstvertrauen dieser Männer gestärkt, ihre Körper schütteten mehr Testosteron aus (was ihnen wiederum wohl ermöglichte, die Aufgabe schneller und besser zu lösen). Auch soziale Faktoren haben also zuweilen Einfluss auf biologische Vorgänge im Körper. Und: Oft hängt es von der jeweiligen Situation ab, wie Frauen und Männer bestimmte Aufgaben lösen, wie sie sich und ihre Fähigkeiten einschätzen.
III. Gibt es spezifisch männliches oder weibliches Verhalten?
Wo die Geschlechter auseinanderliegen – und weshalb Frauen und Männer mehr gemein haben, als sie trennt
Vor allem bei zwei der fünf Hauptfaktoren, mit denen sich die Persönlichkeit eines Menschen erfassen lässt – haben Forscher Unterschiede zwischen den Geschlechtern gefunden:
• bei der Verträglichkeit, die sich aus Facetten wie Altruismus, Rücksichtnahme, Empathie zusammensetzt,
• und beim Neurotizismus, der emotionalen Labilität und Verletzlichkeit.
Beide Persönlichkeitsmerkmale waren bei Frauen im Schnitt stärker ausgeprägt als bei Männern, und das kulturübergreifend. Allerdings fiel der Effekt mal mehr, mal weniger deutlich aus. Er war vergleichsweise groß, wenn die Teilnehmer direkt befragt wurden und ihre Persönlichkeit selbst einschätzen sollten – und deutlich kleiner, wenn die Unterschiede implizit erhoben wurden, zum Beispiel in Assoziationstests. Offenbar ließen sich die Probanden in ihrer Selbsteinschätzung von Stereotypen und sozialen Erwartungen beeinflussen. Frauen hielten sich für empathischer (oder wollten so gesehen werden), Männer gaben sich weniger verletzlich.
Oft haben wir also unbewusst Vorstellungen darüber, wie Männer und Frauen sind und sein sollen. Denn Stereotype prägen unser Selbstbild, unseren Blick auf andere, unser Verhalten. Spätestens im Vorschulalter kennen auch Kinder diese Rollenmuster. Viele Forscher halten Geschlechterunterschiede daher sogar für komplett anerzogen. Generell gilt: Männer und Frauen sind sich ähnlicher, als sie verschieden sind – so formuliert es die US-Psychologin Janet Shibley Hyde in einem Thesenpapier.
Studie belegte: Der größte Geschlechterunterschiede liegt in der Körperbeschaffenheit
Die Professorin an der Universität Wisconsin hat 46 Meta-Analysen ausgewertet, in die wiederum Daten aus mehreren Tausend Studien eingeflossen waren. Sie überprüfte Unterschiede für insgesamt 124 Faktoren, darunter mathematische und sprachliche Leistungen, Wahrnehmung, Motorik, aber auch Aspekte wie Aggression, Sexualverhalten oder Lebenszufriedenheit. Der größte Geschlechterunterschied, den sie dabei fand: Männer werfen ein Wurfgeschoss besser als Frauen; deutlich schneller, deutlich weiter. Auch sprinten sie schneller und haben einen härteren Griff.
Angesichts der Unterschiede in Körpergröße und Muskelmasse war das kein besonders überraschender Befund. Vergleichsweise groß fiel der Unterschied bei einer Aufgabe aus, die das räumliche Vorstellungsvermögen testet. Bei der mentalen Rotation dreidimensionaler Objekte müssen die Probanden sich im Kopf vorstellen, wie eine abgebildete Figur aussieht, wenn sie in eine bestimmte Richtung gedreht wird.
Laut Forschern zeigen Frauen größeres Interesse an Menschen als an Dingen
Männer sind dabei im Vorteil – und zwar überall auf der Welt, in unterschiedlichsten Regionen und Kulturen. Aber je nach Herkunft der Probanden ist ihr Vorsprung mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Und innerhalb der Geschlechter gehen die Leistungen viel weiter auseinander: Zwei zufällig ausgewählte Männer unterscheiden sich in dieser Fähigkeit also oft stärker als ein Mann und eine Frau, die jeweils dem Geschlechterdurchschnitt entsprechen. Bei den meisten kognitiven Leistungen und bei den psychischen Merkmalen waren die Differenzen zwischen Männern und Frauen deutlich geringer. Und für 78 Prozent der untersuchten Variablen konnte Janet Hyde keine oder nur kleine Unterschiede feststellen.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Forscher um die US-Psychologen Ethan Zell und Zlatan Krizan, die 106 Meta-Analysen von Geschlechterunterschieden zusammenfassten: Insgesamt waren das mehr als 20000 einzelne Studien – mit Daten von über zwölf Millionen Menschen. Bei zehn Merkmalen fanden die Forscher größere Abweichungen zwischen den Geschlechtern: Männer sind aggressiver, schneiden bei der Fähigkeit zur mentalen Rotation besser ab und legen bei der Partnerwahl größeren Wert auf physische Attraktivität. Frauen sind schmerzempfindlicher, haben engere Bindungen an Bezugspersonen und zeigen größeres Interesse an Menschen als an Dingen.
Kaum messbare Unterschiede bei psychischen Merkmalen
Wie die Unterschiede zustande kommen, konnten die Wissenschaftler aus ihrem Datenberg zwar nicht ablesen. Bei mehr als drei Vierteln der untersuchten psychischen Merkmale aber fanden sie breite Überschneidungen zwischen Männern und Frauen. Ob kognitive Leistungen, Persönlichkeit, Sozialverhalten oder allgemeines Befinden: Wenn es überhaupt messbare Unterschiede gab, waren sie überwiegend klein oder sehr klein. Wenn Männer und Frauen also derart viel gemein haben: Weshalb glauben dann so viele fest daran, dass die Geschlechter verschieden sind?
Die Antwort der Forscher: Weil Menschen dazu neigen, nicht den Durchschnitt, sondern die Extreme wahrzunehmen – so Zlatan Krizan. Möglicherweise fallen ihnen auch mehrere kleine Unterschiede gleichzeitig auf, die sich zu einem anderen Gesamtbild summieren. Allerdings: Da rund die Hälfte der Wesensmerkmale eines Menschen von den Eltern an die Kinder vererbt werden, spricht vieles dafür, dass einzelne geschlechterspezifische Charaktermerkmale eine erbliche Komponente haben. Hinzu kommen vielfältige pränatale und nachgeburtliche Prägungen sowie Erfahrungen im späteren Kindesalter und in der Pubertät, die ihrerseits einen Teil der Persönlichkeit und des Verhaltens eines Jungen oder Mädchens formen. Auf all diesen Ebenen können kleine biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern auftreten. Die Sozialisation und Prägung durch die Familie kann sie dann ausgleichen – oder verstärken.
Forschung zeigte: Im Mittel trennt die Geschlechter weniger als angenommen
Es gibt sie also, die emotionalen und kognitiven Differenzen zwischen Frauen und Männern. Und auch wenn sie eher klein sind, haben sie im Einzelfall wohl erkennbare Auswirkungen. Zugleich zeigt die Forschung: Im Mittel trennt die Geschlechter in ihrem Denken, Fühlen und Verhalten weniger als oft angenommen – und eine mutmaßlich typische Eigenschaft sagt wenig aus über die ganze Persönlichkeit. Ein Mann, der sich über seine Gefühle ausschweigt, ist deshalb noch lange kein pragmatischer Problemlöser, der Konkurrenz und Wettkampf liebt. Und eine Frau, die jede ihrer Emotionen in stundenlangen Gesprächen sezieren möchte, hat sich vielleicht in ihrem Leben noch nie verlaufen und kann großartig Karten lesen. Und so wenig wir uns das eigene Geschlecht aussuchen können: Es weist unser Wesen wohl nicht in Schranken, die nur eine andere Art Mensch überwinden könnte.