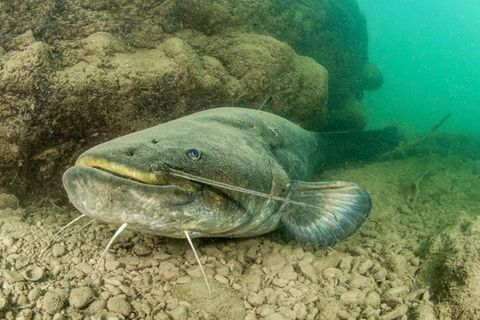Schon im Frühsommer recken erste Pfifferlinge ihre leuchtenden Hüte aus dem Waldboden. Den Namen verdanken die Pilze ihrem wunderbar pfeffrigen Aroma. Seit dem Altertum ist die (in Süddeutschland auch als "Eierschwammerl" bekannte) dottergelbe Köstlichkeit begehrt.
Was wir in der Pfanne braten, ist aber nur ein kleiner Teil des Pfifferlings, vereinfacht gesagt: seine Früchte. Der eigentliche Pilz wächst unterirdisch als Myzel – ein verzweigtes Geflecht hauchdünner Fäden.
Das Myzel kann sich über viele Quadratmeter erstrecken. Und es steht in enger Partnerschaft mit Bäumen: Die Fäden wickeln sich um Wurzelspitzen, vergrößern deren Oberfläche – so kann die Pflanze mehr Wasser und Nährsalze aufnehmen. Im Gegenzug versorgt der Baum den Pfifferling mit energiereichen Kohlenhydraten, die er via Photosynthese in seinen Blättern bildet und hinunter zu den Wurzeln leitet.
Ohne Pilze keine Landpflanzen
Es ist also ein Deal von wechselseitigem Nutzen. Und er ist schon sehr alt. Man geht davon aus, dass die Symbiose zwischen Pilzen und Pflanzen bereits vor mehr als 400 Millionen Jahren entstand. Und dass eben diese Hilfe von Pilzen ein wesentlicher Faktor war, weshalb die Pflanzen einst das Land erobern konnten.
Manche Pilze gehen nur Partnerschaften mit einer Baumart ein, der Pfifferling aber kann mit vielen: Daher findet man ihn in Buchenwäldern ebenso wie unter Fichten, Eichen oder Kiefern.
Seine goldenen Fruchtkörper bildet der unter Naturschutz stehende Pilz bis in den November hinein (geringe Mengen dürfen gesammelt werden). Nicht verwechseln sollte man ihn allerdings mit dem weniger schmackhaften Falschen Pfifferling, der sich aber recht einfach erkennen lässt: Die Lamellen unter seinem Hut sind deutlich dünner als die etwas dicklichen Leisten des delikaten Echten.