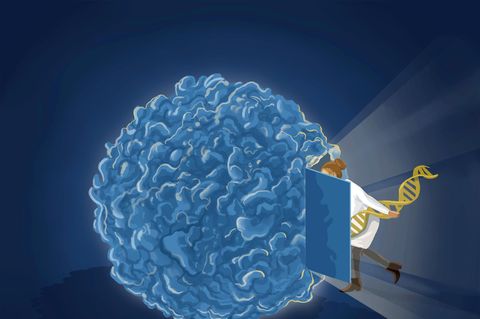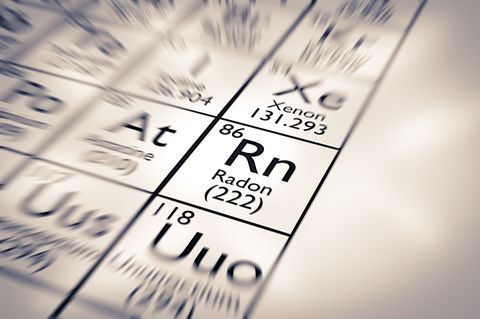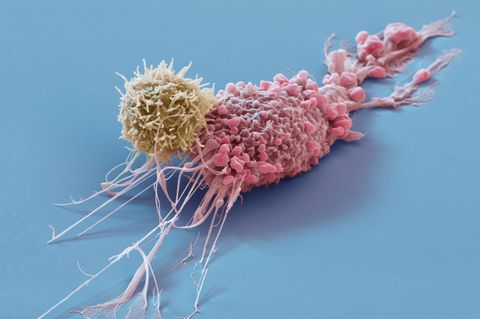Nur wenige kennen ihn, gesehen haben ihn die wenigsten: den Frühlings-Feenkrebs. Charakteristisch für den bis zu 35 Millimeter langen Gliederfüßer sind die elf Beinpaare, die gleichzeitig der Fortbewegung und der Atmung dienen. Die urtümlichen Lebewesen haben ihr Aussehen seit Hunderten Millionen Jahren kaum verändert. Und gleiten von Januar bis Anfang Mai – mit dem Bauch nach oben – feenhaft durch das Wasser kleiner Tümpel, in denen es weder Strömung noch Fische gibt. Und die im Sommer austrocknen.
Dass Eubranchipus grubii, so der wissenschaftliche Name, ausgerechnet auf Gewässer spezialisiert ist, die nur wenige Monate existieren, mag auf den ersten Blick erstaunen. Und doch sind die Wassertiere an die kurzen Zyklen zwischen Nässe und Austrocknen perfekt angepasst.
Stimmen die Bedingungen, schlüpft aus einem Dauer-Ei, auch Zyste genannt, die Larve oder Nauplie. Nach nur zwei Wochen ist der Krebs geschlechtsreif, und die Weibchen heften die befruchteten Eier an den Grund des Tümpels.
Eile ist geboten – denn viele Senken, Mulden oder staunasse Flächen in den Flussniederungen trocknen nach dem Winter schnell wieder aus. Für den Feenkrebs ist das kein Problem. Denn im Boden können die Zysten jahre-, vermutlich sogar jahrzehntelang ohne Wasser überleben. Um das langfristige Überleben der Art zu sichern, schlüpfen die Feenkrebse nicht alle zur gleichen Zeit – sondern um Jahre zeitversetzt. So können die Krebs-Populationen auch mehrere trockene Winter mit niedrigen Wasserständen überstehen.
Wo kommt der Feenkrebs vor?
Vor allem im Norden und Osten Deutschlands, entlang von Spree, Havel, Elbe, Aller, Leine, Hunte und Ems, aber auch in feuchten Wäldern ist der Krebs noch relativ häufig zu finden. Nach Süden allerdings dünnen die Vorkommen aus. Fachleuten zufolge liegt das daran, dass hier schon früh Flüsse reguliert, Auen entwässert und Grundwasserspiegel abgesenkt wurden. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels: höhere Temperaturen und mehr Trockenheit. Besonders in den letzten Jahren sind immer mehr Vorkommen verschwunden. Deutschlandweit gilt die Art heute als "stark gefährdet".
Doch wer weiß? Vielleicht gibt es den Frühlings-Feenkrebs noch an Stellen, an denen bislang niemand Ausschau gehalten hat. Der Nabu Mecklenburg-Vorpommern ruft Naturfreundinnen und Naturfreunde dazu auf, mit der App "Vielfalt erforschen" zu melden.