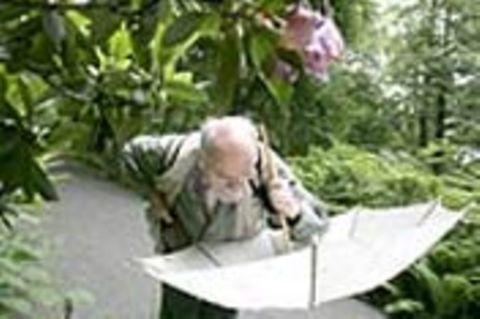Freitag, 16. Juni: Eröffnung
Auftakt im "Land der Paläste"
Die Franzosen nennen die Gegend noch heute "Palatinat", und auch das deutsche Wort "Pfalz" bedeutet ursprünglich dasselbe: Palastland. Unweit von hier, in Kaiserslautern, stand die Kaiserpfalz Friedrich Barbarossas, und nirgendwo in Deutschland liegen mehr Kaiser begraben als im pfälzischen Dom zu Speyer. Unzählige Burgen bewachten einst den Reichtum des Landes. Doch nach verheerenden Kriegen, zwischen Bauern und Adel, Protestanten und Katholiken, Deutschen und Franzosen sind von der einstigen Pracht nur Ruinen geblieben - wie die mahnende Silhouette der Burg Fleckenstein zwischen Pfalz und Elsass, unterhalb derer der GEO-Tag der Artenvielfalt diesmal beginnt. Rund 80 Experten aus Deutschland und Frankreich sind zur Auftaktveranstaltung gekommen.
Der fabelhafte Wald
Warm und leicht klebrig wirkt die Luft, Geräusche sind nur gedämpft zu vernehmen. So ruhig liegt die Abendluft, dass sich Hunderte von Glühwürmchen über der Wiese tummeln. Kein Zweifel, dieser Ort ist von eigener Art. Hier bin ich nicht in der Stadt, nicht auf dem flachen Land bei Hamburg, wo ich arbeite, und wo der frische Wind von der Küste allzu oft die Wärme wegfegt. Nach Jahrzehnten bin ich wieder im Land, wo ich meine Jugend verbracht habe. Hier regiert der Wald. Und bedeckt die größte Fläche in ganz Deutschland, grenzüberschreitend nach Frankreich hinein. Ein idealer Lebensort für bedrohte Tierarten wie die Wildkatze oder den Luchs, die ausgedehnte Jagdgebiete brauchen. Und im Dunkel der Baumkronen mag sich sogar manch Unbekanntes verstecken. Elwetritsche etwa, Wolperdinger-artige Fabelwesen, von denen es heißt, man könne sie nur fangen, wenn man ihnen Salz auf den Schwanz streut - "Elwetritsch" bedeutet übersetzt "Elfensteiß". Irgendwo zwischen Fabel und echtem Nachweis bewegt sich die Behauptung eines Jägers auf dem ehemaligen US-Truppengelände "Area One", in das sich Säugetier-Experte und Vogelkundler Marc Schneider in der Nacht vorgewagt hat. Einen Schlangenadler habe er neulich gesehen, ein Tier, das längst in der Region als ausgestorben gilt. Vielleicht nur Jägerlatein - beziehungsweise Jägerpfälzisch. Aber dennoch: Bei starkem Sturm könnten Vögel tatsächlich weit abgetrieben werden und dann zum Beispiel im Pfälzerwald wieder heimisch werden.
Der Humus: Schicht um Schicht
Auch Asseln betreiben Geschichte. Sobald das Holz zu modern beginnt, machen sich die landlebenden Verwandten der Flusskrebse daran, das Material zu zersetzen - ein Werk, das Pilze und Mikroorganismen schon begonnen haben, von denen sich die Asseln mit ihren feinen Wundwerkzeugen dann ernähren. Das Ergebnis ist fruchtbarer Humus. Wie zum Beispiel an den feuchten Hängen unterhalb der Burg Fleckenstein, wohin mich der Asselexperte Christian Schmidt führt. Der Mitarbeiter am Museum für Tierkunde in Dresden hat an allen GEO-Tagen teilgenommen, mit Ausnahme des zweiten. Zwar gebe es internationale Asselkonferenzen, aber da sei er seltener als bei unseren Veranstaltungen. Der Grund: Es bietet eine gute Gelegenheit, in artenreiche Regionen zu gelangen, in die man sonst kaum kommen würde. Auch diesmal wird Schmidt belohnt: 16 Arten von insgesamt etwa 55, die in Deutschland vorkommen - das sind überdurchschnittlich viele an einem Tag. Und worin unterscheiden sie sich? Zum Beispiel daran, wie weit sie sich krümmen können: Die gewöhnliche Kellerassel etwa schafft es nur zum "C", der Assel auf Fleckenstein hingegen gelingt die komplette Rolle. Wer hat das Rad erfunden? Die Assel!
Die französische Art
"Sie machen ja keinen Unsinn", sagt Charlie Schlosser und schließt mir das Tor auf. Eigentlich ist die Ruine Fleckenstein für die Öffentlichkeit versperrt, Zutritt verboten wegen Bauarbeiten. Nur ein Gerüst führt hoch auf die eigentliche Burg. Aber der Bürgermeister der Elsassgemeinde Lembach hat genug Vertrauen in mich und lässt mich alleine die Burgmauern erklimmen. "Nicht zu fassen", denke ich. Welcher deutsche Würdenträger oder Beamte hätte es gewagt, Versicherungsvorschriften hintanzustellen zugunsten vertrauensbildender Maßnahmen? Zum Dank bin ich besonders vorsichtig. Und werde mit einem spektakulären Blick über die anmutigen Hügel der Umgebung belohnt. Als ich dann wieder im Tal bin und hochschaue, sieht die Silhouette der Burg im Abendlicht aus wie eine Faust. Mit Daumen hoch!
Von Bären und Spannern
Als es dunkel ist, entzündet Ernst Blum das UV-Licht. Zahllose Nachtfalter stürzen sich ins Netz, das die Lichtquelle umgibt. Und auf durchschnittlich zehn Falter entfällt jeweils eine Art. Sie unterscheiden sich unter anderem auch durch ihre Fortbewegung im Raupenstadium. "Warum heißen die Spanner ‚Spanner'?", fragt Blum in die Runde. Nein, nicht wegen der Spannweite ihrer Flügel, sondern weil die Raupe so gespreizte, überstreckte Bewegungen macht. Auch "Bären" gehen ins Netz - so genannt, weil sie als Raupe ein dichtes "Fell" haben.
Samstag, 17. Juni: Hauptveranstaltung
Kirchengeschichte
Der Hauptaktionstag morgens früh beginnt in der "Wappenschmiede" beim Biosphärenhaus am Rand von Fischbach bei Dahn. Poster und Tafeln informieren über das Geschehen und die Natur. Mich interessiert eine Notiz über Biber, die hier wieder angesiedelt wurden. In früherer Zeit habe man die Tiere zu den Fischen gezählt, aufgrund ihres schuppigen Schwanzes. Der eigentliche Grund: Durch dieses Zugeständnis der Kirche durfte in der Fastenzeit das Biberfleisch gegessen werden. Ob heutige Biologen so gnädig sein würden, Bibern zu den Fischen zu zählen, darf bezweifelt werden.
Sexgeschichten
Auch der Spinnenexperte Theo Blick ist mit mir am Rösselsweiher bei Ludwigswinkel unterwegs. Auf einen einzigen Quadratmeter Waldboden kommen bis zu 1000 Tiere vor, sagt der Wissenschaftler vom Senckenberg-Museum in Frankfurt. Die meisten der Spinnen sind allerdings so klein, dass man sie kaum sieht. Und wie kann man dann erkennen, ob es sich um unterschiedliche Arten handelt? Mit einem genauen Blick auf die Geschlechtsorgane, sagt der Experte. Und wie sehen die aus? Das Weibchen hat eine chitingeschützte Bauchöffnung; das Männchen aber besitzt keinen Penis, sondern transportiert seinen Samen mit umgebauten Beinen ins Ziel. Diese Werkzeuge sind so präzise geformt, dass sie nur bei der richtigen Art wie der Schlüssel ins Schloss passen. Interessant.
Gruselgeschichten
Wir quetschen uns durch die enge Öffnung des vergitterten Eingangs und befinden uns an einem unguten Ort. Adolf Hitler hat um 1935 herum diese Gänge anlegen lassen als Teil des Westwalls. In ihnen sollte Munition gelagert werden und Schützen sollten von hier auf angreifende Franzosen schießen. Der Diktator wollte so verhindern, dass das Nachbarland Deutschland in den Rücken fällt, wenn er Polen angreift. Zumindest wurden diese Anlagen für den Krieg nie gebraucht. Und sie dienen heute als Biotope zum Beispiel für überwinternde Fledermäuse. Die Fledermäuse sind heute streng geschützt, zum Beispiel, weil sie die einzigen nennenswerten Feinde nachtaktiver Insekten sind - sie vertilgen fast ein Drittel ihres Körpergewichts an Insekten pro Nacht, sagt der Fledermausforscher Franz Grimm. Und in den Gängen finden sich auch spezielle Höhlentiere, die wegen der ewigen Dunkelheit farblos und blind sind. Dass sie nichts sehen, beweist auch ein Versuch, den der Höhlenbiologe Dieter Weber vorbereitet hat: Kein einziges Tier ist in die aufgestellte Leuchtfalle am Ende der Höhle gegangen, obwohl wir an den Stollenwänden Schlupfwespen, Köcherfliegen, Mücken und Fliegen gefunden haben. Dennoch lauert dort Meta menardi, die größte Höhlenspinne Mitteleuropas. Kaum zu glauben, dass ein Wesen sich in einer dunkeln Höhle vollfressen kann. Tatsächlich gebe es sehr wenige Beutetiere im Innern solcher Gänge, bestätigt Weber. Aber es gebe auch nur wenige Exemplare der großen Höhlenspinnen. Wenige Exemplare gibt es hoffentlich auch von den Menschen, die im Innern der Höhle ein Teufelszeichen hinterlassen haben und sich vermutlich mit Eisensäge am Gitter zu schaffen gemacht haben. Vielleicht Nazigoldjäger oder Schlimmeres, meint Weber.
Resümee
Am Ende des Tages sind rund 1.500 Arten der verschiedensten Tiere und Pflanzen gesichtet worden. In der Gruppe der Vögel konnten die Experten rund 80 Arten nachweisen, darunter auch gefährdete Wanderfalken (Falco peregrinus), Kolkraben (Corvus corax), Wespenbussard (Pernis apivorus) und Baumfalke (Falco subbuteo). Unter den rund 140 Schmetterlingsarten fand sich auch der Moosbeeren-Perlmutterfalter (Argyronome aquilonaris), der in der Roten Liste Rheinland-Pfalz als vom Aussterben bedroht eingestuft ist. Reiche Beute machen auch die Botaniker, am Ende des Tages zählten sie rund 400 Höhere Pflanzen. Alle Daten werden demnächst auf www.naturgucker.de zugänglich sein.
GEO bedankt sich herzlich bei allen Experten für ihr Engagement und die großzügige Unterstützung durch die Kooperationspartner. Ein spezieller Dank geht an Julia Burkei und ihr Team von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Und nicht zuletzt auch an die Übersetzerin Catherine Bastien-Defert, der es gelungen ist, auch Sprachgrenzen problemlos zu überwinden.
Die umfassenden Ergebnisse der großen Recherche werden in der September-Ausgabe von GEO zu lesen sein.
Weitere Informationen auf der Homepage des GEO-Tags der Artenvielfalt.