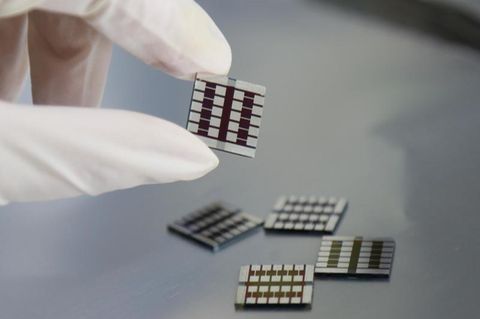Professor Ortwin Renn ist Direktor des Zentrums für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung an der Universität Stuttgart. Mit Gedanken zur Energiewende war er auch einer der Referenten bei den 12. Münchner Wissenschaftstagen vom 20. bis 23. Oktober. Für GEO 11/2012 schrieb er seine Gedanken zur Energiewende nieder.

Warum die Energiewende an zu viel unbedachtem Enthusiasmus scheitern könnte
Spätestens seit Fukushima steht Deutschland vor drei großen Veränderungen seines Energiesystems:
Zunächst müssen wir eine Reduktion der fossilen Energieversorgung von heute 80 Prozent auf unter 20 Prozent bis zum Jahr 2050 herbeiführen - eine enorme Herausforderung. Dabei ist es politisch gewollt, zweitens, dass wir die fossile Energie durch regenerative Energieträger ersetzen, also nicht durch Kernenergie. Im Klartext: Die unbeständigen Energieträger Sonne und Wind sollen die Hauptlast übernehmen, flankiert durch Wasserkraft, Geothermie und Biomasse. Da sind neue, intelligente Lösungen für die Stromnetze nötig - denn der Ertrag von Wind und Sonne lässt sich nicht vorausplanen. Dazu kommt, drittens, ein Faktor, der oft vergessen wird: Um die erklärten Ziele der Regierung zu erreichen, müssten die Bürger bis zum Jahr 2050 zusätzlich noch etwa 40 Prozent ihres Primärenergiebedarf einsparen. Zum Großteil wird diese Einsparung aus besserer Energieeffizienz kommen müssen.
Das alles wird nicht ohne Folgen im sozialen und politischen Kontext bleiben: Wir werden komplexere Systeme und Netze benötigen - und die sind viel leichter verwundbar. Etwa durch Hacker, die in "Smart Grid-Systemen" (d. h. durch computergesteuerte Stromnetze) zum Beispiel alle dort vernetzten Waschmaschinen der deutschen Haushalte zum gleichen Zeitpunkt einschalten könnten, um das Netz zusammenbrechen zu lassen.
Dazu kommen weitere Probleme, die aus der Vernetzung unserer Versorgungsleistungen entstehen: Wenn wir auf regenerative Energie umsteigen, dann ist es notwendig, dass wir Strom verbrauchen, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, und dann weniger Strom nachfragen, wenn es bewölkt und windstill ist. Das kann man aber nur mit entsprechenden Steuerungseingriffen über Computer und Internet sicherstellen. Beispielweise können alle Gefriertruhen auf maximale Leistung getrimmt werden, wenn es gerade viel Strom gibt, und mit einem Minimalprogramm laufen, wenn es entsprechend wenig Strom gibt.
Eine ernstgemeinte Energiewende bringt zwangsläufig Probleme mit sich
So eine Vernetzung bringt viele Vorteile, denn sie gleicht die Schwankungen in der Nachfrage nach Strom aus. Sie ist aber auch mit neuen Problemen verbunden. So kann es sein, dass jemand gerade bei einem geringen Angebot an Strom die Kühltruhe mit frischem Fleisch füllen will, wofür eine maximale Leistung zum Einfrieren gebraucht würde.
Noch problematischer sind Fragen des Datenschutzes: Will man wirklich Informationen über die eigenen Gewohnheiten mit dem lokalen Energieanbieter teilen? Will man nur dann seine Wäsche waschen, wenn gerade viel Strom verfügbar ist? Die Gesellschaft wird sich außerdem einigen müssen auf ein möglichst effizientes Miteinander von zentralen und dezentralen Energieversorgungseinheiten. Was zu erheblichen Debatten führen wird, weil dezentrale Anlagen zwar populär sind, aber im Notfall die Versorgungssicherheit nicht garantieren können.
Und auch das Verhältnis von Stromproduzent und Stromverbraucher wird sich wandeln: Mit einer ernstgemeinten Energiewende wird es zwangsläufig immer mehr "Zwitter"-Modelle geben, in denen diese Rollen nicht mehr klar verteilt sind. Schon heute ist es bei Fotovoltaik-Anlagen so, dass derjenige, der die Anlage auf dem Dach hat, gleichzeitig Produzent und Konsument (oder: "Prosument") ist. Das führt schon jetzt, im kleinen Rahmen, zu Verwicklungen bei der Preisgestaltung, weil die Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage nicht mehr wie im Lehrbuch funktionieren. Ein Problem, das sich mit der Energiewende vervielfachen dürfte.
Für die Energiewende sind Zugeständnisse nötig

All das erfordert viel Kooperationsbereitschaft von allen Beteiligten - und kann nur gelingen, wenn die Nutzer der Energie und die Anwohner neuer Anlagen bei der Energiewende aktiv mitmachen. Das ist beileibe nicht selbstverständlich. Zwar sind mehr als 75 Prozent der Deutschen Umfragen zufolge "für die Energiewende". Gleichzeitig hat sich aber die Haltung breitgemacht, dass diese Wende schon von Politik und Wirtschaft gemeistert werden könne - und zwar bei voller Versorgungssicherheit, mit annehmbaren Preisen und ohne weitere Umweltbelastungen. Eine trügerische Zuversicht! Denn wenn einmal klar wird, dass die Energiewende nicht ohne Zugeständnisse auf allen Seiten zu haben ist, wird der Enthusiasmus in Enttäuschung und Skepsis umschlagen.
Es wird dann eine neue Welle von Akzeptanzproblemen kommen, die durchaus ähnliche Züge annehmen könnte, wie wir es in der Debatte um Kernenergie erlebt haben. Immer dann, wenn wir etwa neue Netze verlegen, wenn wir große Pumpspeicherkraftwerke bauen, um Strom für Phasen ohne Wind und Sonne zwischenzuspeichern, immer dann werden Anwohner rebellisch. Das war so bei dem geplanten Speicherkraftwerk in Atdorf (Baden-Württemberg) und ist bis heute so bei den geplanten Trassen, die Strom von Windkraftwerken in der Nordsee bis nach Süddeutschland leiten sollen.
83 Prozent äußern Verständnis, wenn Anwohner gegen neue Stromnetze protestieren
Das Institut für Demoskopie in Allensbach hat gerade eine Umfrage veröffentlicht, in der 83 Prozent der Befragten Verständnis dafür äußern, dass sich die Anwohner von geplanten Stromnetzen gegen diese zur Wehr setzen. Der Anteil von 83 Prozent sinkt auf gerade einmal 76 Prozent, wenn die Frage mit dem Zusatz versehen wird, dass über das neue Netz Ökostrom verteilt wird und dass die Mehrheit der Bewohner dieses Vorhaben doch eigentlich befürwortet. Das sind keine ermutigenden Ergebnisse.
Eine "eierlegende Wollmilchsau" der Energieversorgung, die gleichzeitig Versorgungssicherheit zu annehmbaren Preisen sowie klima- und umweltverträgliche Energie garantiert, wird es nicht geben. Wir werden lernen müssen, mit den Zielkonflikten umzugehen. Frühzeitig und schonungslos die Menschen über unvermeidbare Belastungen aufzuklären und sie darauf vorzubereiten, dass die Energiewende zum Beispiel höhere Energiepreise und Verhaltensanpassungen an schwankende Energieangebote bedeuten kann: Das wäre das A und O einer vorbeugenden Akzeptanzpolitik.
Viele Debatten um Kernenergie, um neue Chemieanlagen oder um die Erneuerung des Hauptbahnhofs in Stuttgart beweisen eindrücklich, dass Akzeptanzbeschaffung im Nachhinein nicht funktioniert.
Weniger heizen, dafür Pullover tragen. Weniger Auto, häufiger Fahrrad fahren
Was jetzt nötig wäre: Energieanbieter, Energiepolitiker und Umweltverbände müssten (gemeinsam!) offen und konstruktiv den Dialog mit der Bevölkerung suchen, auf die Chancen hinweisen und Probleme nicht verschweigen. Dabei sollte klar unterschieden werden zwischen absurden Illusionen (etwa dass wir alle Energie lokal generieren könnten) und echten Optionen, die in einer Demokratie auch wirklich Realisierungschancen haben. Nur durch Aufrichtigkeit entsteht Vertrauen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Botschaft, dass eine Energieeinsparung von 40 Prozent ohne Änderungen des eigenen Verhaltens nicht erreicht werden kann.
Und zwar ganz konkret und ungeschminkt: weniger heizen, dafür Pullover tragen. Weniger Auto, häufiger Fahrrad fahren. Auch das gehört zu einer gelingenden Energiewende. Wenn das nicht frühzeitig klar wird, könnte sich der heute noch spürbare Enthusiasmus für die Wende bald ins Gegenteil verkehren. Möglich, dass dann der Ruf nach mehr Kohle und sogar nach mehr Kernkraft wieder erschallen wird, um in eine für den Konsumenten preiswerte und bequeme Energiewelt zurückzukehren.
Wollen wir aber die aktuelle Dynamik zu einer wirkungsvollen Wende in der Energieversorgung erhalten, dann gilt es nicht nur, neue Techniken zu entwickeln und neue smarte Systemlösungen auf den Weg zu bringen, wir müssen auch aktiv die Beteiligung der Öffentlichkeit vorantreiben. Sonst heiß es am Ende: Wir haben die Energiesparrechnung ohne den Kunden gemacht.