Laut Wildtierexperte Moritz Klose ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Braunbären nach Deutschland zurückkommen. Man hätte jetzt die Gelegenheit, sich darauf vorzubereiten und die Bevölkerung zu sensibilisieren, um eine friedliche Koexistenz zu gewährleisten.
GEO: Herr Klose, Ihr Buch "Im Reich der Bären" befasst sich unter anderem mit dem Bärenmanagement in Deutschland. Die Anwesenheit des Wolfes löst regelmäßig hitzige Debatten aus. Wie steht es um die Akzeptanz von Bären?
Moritz Klose: Es kommt darauf an, wen man fragt. In den meisten Teilen Deutschlands ist es den Menschen gar nicht so bewusst, dass es hier einmal Bären gab und theoretisch auch wieder geben könnte. Im bayerischen Alpenraum, wo die Rückkehr am wahrscheinlichsten ist, herrscht schon auch Ablehnung den Tieren gegenüber. Als ich Amtsmitarbeitende in Bayern fragte, wer sie mehr beunruhige, der Bär oder der Wolf, lautete die Antwort: "Der, der gerade da ist." Trotzdem denke ich, dass ein größerer Respekt vor den Bären herrscht, weil Begegnungen für Menschen prinzipiell tödlich ausgehen können. Aus anderen Teilen Europas hört man immer wieder, dass Wanderer von Bären angegriffen werden. Die letzten Sichtungen in Deutschland waren aber vor zwei Jahren, das ist sehr überschaubar.
Wird die Zahl der Sichtungen in Zukunft steigen?
Wir müssen immer häufiger mit Bären im Alpenraum rechnen. Sie sind in der EU seit den 1990er-Jahren geschützt, und die Bestände erholen sich. Wir gehen von mehr als 20.000 Braunbären in Europa aus, das entspricht einer Zunahme von ungefähr 20 Prozent in den letzten zehn Jahren. Hierzulande werden bis auf absehbare Zeit jedoch nur einzelne Tiere vorkommen, wahrscheinlich als Grenzgänger zwischen Deutschland, Österreich, Italien und Slowenien. In dem Fall wäre eine gute grenzübergreifende Kommunikation wichtig, sodass man sich schnell gegenseitig informieren und unterstützen kann.
Inwiefern wird die Rückkehr der Bären für uns eine Herausforderung?
Wir haben in Deutschland die Erfahrung mit den Bären verloren, weil sie seit über 170 Jahren nicht mehr dauerhaft bei uns vorkommen. Das Zusammenleben müssen wir erst wieder lernen. Viele Menschen tun sich schwer mit solchen Veränderungen. Wenn die Wildtiere zurückkommen, bedeutet das aber, dass wir uns ein Stück weit anpassen müssen. Es braucht den Willen zur Veränderung.
Heißt das, wir müssen uns aus der Natur zurückziehen?

Nein, wir müssen nur wissen, wie man sich richtig verhält. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber in Wandergebieten mit Bärenvorkommen kann es zu potenziell gefährlichen Begegnungen kommen. Die richtige Verhaltensweise kann dann lebensrettend sein. Bären greifen Menschen nicht an, um sie zu fressen, sondern wenn sie sich bedroht fühlen. Sie suchen in der Regel das Weite, sobald sie Stimmen hören oder unsere Witterung aufnehmen. Deshalb sollte man sich als Mensch zu erkennen geben, zum Beispiel durch Sprechen oder Singen, damit es nicht zu Überraschungsbegegnungen kommt. Wenn man einen Bären sieht, sollte man sich langsam ohne Panik zurückziehen. Im Falle eines Angriffs muss man, so schwer es auch ist, die Nerven behalten und sich auf dem Bauch liegend totstellen. Es geht immer darum, dem Tier zu signalisieren: Von mir geht keine Gefahr aus.
Bei Schwarzbären in Kalifornien ist eine Landflucht zu beobachten, weil sie in Mülleimern ständig Nahrung finden. Welche Folgen hat das?
Die Futterkonditionierung ist ein Problem. Bei Bären muss man darauf achten, dass sie nicht an leicht erreichbare Futterquellen wie ungesicherte Mülleimer oder Komposthaufen gelangen oder gezielt angefüttert werden. Daran können sie sich derart gewöhnen, dass sie die Nähe von Menschen aufsuchen. Das habe ich in Rumänien erlebt: Ich fuhr eine Straße entlang, und am Straßenrand wartete ein Bär. Als ein Bus heranfuhr und der Busfahrer einen Apfel hinauswarf, kam der Bär sofort zum Fahrerfenster. Aus einem weiteren Auto schmiss jemand eine Schnitte. Ich traute meinen Augen nicht. Genau so konditioniert man einen "Problembären".
Hinzu kommt, dass gar keine Notwendigkeit für einen langen Winterschlaf besteht, wenn es in milden Wintern eine hohe künstliche Nahrungsverfügbarkeit gibt. Das kann zu einem gestörten Biorhythmus der Bären führen. Außerdem steigt ohne Winterschlaf die statistische Wahrscheinlichkeit für Begegnungen von Bären und Menschen. Man muss aber dazu sagen, dass wir hierzulande ein sehr gutes Müllabfuhrsystem haben, daher ist bei uns das Risiko relativ gering.
Ist "Menschenmanagement" genauso wichtig wie Bärenmanagement?
Ich würde sagen, es ist sogar noch wichtiger. Am Anfang eines jeden "Problembären" stehen Problemmenschen, die sich falsch verhalten.
Das wurde dem Braunbären Bruno zum Verhängnis, der 2006 nach Deutschland kam und den Begriff "Problembär" erst geprägt hat.
Brunos Fall wurde heiß diskutiert. Mehrere Experten sagen im Nachhinein, dass er in der Anfangsphase nie gefährlich für Menschen war und nicht hätte erschossen werden müssen. Zwar hat er von seiner Mutter, die selbst von Menschen angefüttert wurde, gelernt, dass er in Siedlungsnähe Futter finden kann. Trotzdem mied er die Menschen und zog von Dorf zu Dorf, um dort vor allem Schafe und Ziegen zu fressen. Man hat versucht, ihn einzufangen, was aber nicht funktionierte. Erst später kam es zu einem regelrechten Sensationstourismus. Menschen sind Bruno hinterhergelaufen oder mit dem Mountainbike auf ihn zugefahren. Und so haben sie ihn erst wirklich zum "Problembären" gemacht. Weil Bruno diese Nähe geduldet hat, entschieden sich die Behörden, ihn zu erschießen, da er ein unkalkulierbares Risiko für Menschen darstelle.
Gibt es Alternativen zum Abschuss?
Wenn man Tiere mit problematischem Verhalten entdeckt, wäre der erste Schritt, sie mit Knallapparaten oder Gummischrot zu vergrämen, sobald sie sich Siedlungen und Tierherden nähern. Dazu ist das Monitoring wichtig, also die Überwachung der Bärenpopulation. So weiß man, wo die Tiere sind, wie viele es gibt und wie sie sich verhalten. Das funktioniert mit GPS-Halsbändern, Fotofallen und genetischem Monitoring, also der Analyse von Losungen oder Fell von Kratzstellen an Bäumen.
Haben wir dazu die nötigen Kapazitäten?
Es gibt schon Ansätze, zum Beispiel ein Netzwerk aus ehrenamtlichen geschulten Personen, die sich im Monitoring von großen Beutegreifern engagieren. Das ist eine gute und wichtige Grundlage. Die Landesbehörden beschäftigen sich ebenfalls mit dem Wildtiermanagement, aber in den Kommunen gibt es weniger Kapazitäten. Dort bräuchte es Zuständige auf Landkreisebene, die geschult und befähigt sind, schnell zu handeln.
Halten Sie das Bejagen einzelner Tiere in Ausnahmefällen für sinnvoll?
Eine zielgerichtete Entnahme kann notwendig sein, wenn Bären ein mögliches Risiko für Menschen sind und sich nicht vergrämen lassen. Dann müssen einzelne Tiere im schlimmsten Fall erschossen werden. Da muss man aber wirklich differenzieren, und das kommt in der Diskussion oft zu kurz. Der Bär ist in Europa streng geschützt und darf nur in bestimmten Ausnahmen entnommen werden. Die rumänische Regierung hat 2024 und 2025 die Entnahme von je 420 "Problembären" festgelegt. Das ist problematisch, weil im Prinzip eine Jagdquote durch die Hintertür eingeführt wird, die so eigentlich nicht EU-rechtskonform ist. Ob damit tatsächlich die Bären mit problematischem Verhalten erwischt werden, ist fragwürdig.
Aus ökologischer Sicht sind Jagdquoten nicht notwendig. Raubtiere haben zwar keine größeren Feinde, aber sie werden durch die Nahrungsverfügbarkeit und weitere Faktoren reguliert. Wenn es zu viele Bären gibt, verbreiten sich Krankheiten unter ihnen oder innerartliche Aggression nimmt zu, Tiere wandern ab oder pflanzen sich weniger fort, und ihr Bestand wird somit reguliert. Es braucht kein Eingreifen des Menschen. In einigen Ländern ist die Jagd jedoch Teil der Kultur. In Slowenien werden Bären seit Jahrhunderten gejagt und ihr Fleisch verzehrt. Den Bärenbeständen dort geht es gut, und es gibt eine relativ hohe Akzeptanz den Raubtieren gegenüber.
Wie wichtig ist es, Raum für Bären in unserer Landschaft zu lassen?
Ich finde, es ist eine Frage der Haltung. Wir befinden uns in einer Artenkrise und erleben ein Artensterben, das zehn bis 100 Mal höher ist, als es ohne den Menschen wäre. Wir laufen riesige Gefahr, in den nächsten 100 Jahren bis zu eine Million Arten zu verlieren und das hätte unmittelbare Folgen für uns Menschen. Die Natur stellt unsere Lebensgrundlagen bereit: Saubere Luft, saubere Böden, sauberes Wasser. Aber nur, wenn wir intakte und vielfältige Ökosysteme haben. Dazu gehört jede Art, und wir müssen uns um ein Zusammenleben mit jenen Arten bemühen, die von allein zurückkommen. Im Ökosystem tragen Braunbären zur Verbreitung von Samen und zur Gesundhaltung von Beutetierpopulationen bei, weil sie vor allem junge, kranke und alte Wildtiere jagen. Und wir haben in Deutschland historisch hohe Schalenwildbestände.
Warum zieht es Bären dann in die Nähe von eingezäunten Tierherden?
Bären und Wölfe sind Opportunisten. Sie nehmen die Nahrung, die leicht verfügbar ist. Schlecht geschützte Herden sind wie ein All-you-can-eat-Buffet. Damit beispielsweise Schafe nicht herauskommen, genügen schon ein oder zwei stromführende Drähte. Aber um Raubtiere am Reinkommen zu hindern, reicht das nicht.
Wenn Wölfe oder Bären eine solche Herde angreifen, töten sie viele Tiere, ohne sie zu fressen. Wie erklärt sich dieses Verhalten?
Man spricht vom Beuteschlagreflex. Er entsteht, weil die Situation für die Tiere unnatürlich ist. In der Natur würden sie niemals so viele Beutetiere vorfinden, die nicht flüchten können. Die wiederholten Fluchtversuche lösen den Reflex zu töten aus. In den kommenden Tagen und Wochen würden die Bären immer wieder zurückkommen und die erlegte Beute auffressen, wenn man sie liegen ließe.
Wie können Tierhalter*innen ihre Herden schützen?
Mit Elektrozäunen, die bodenabschließend sind und viel Spannung haben. Wenn diese speziellen Herdenschutzzäune gut installiert und regelmäßig kontrolliert werden, helfen sie gegen Wölfe, Bären, Luchse und Goldschakale. In Osteuropa, wo es all diese großen Beutegreifer gibt, werden Weidetiere häufig dauerhaft behütet, aber auch solche Zäune kommen erfolgreich zum Einsatz. Herdenschutzhunde sind ebenfalls eine erprobte Maßnahme. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es jedoch nicht.
Herdenschutzhunde müssen trainiert und versorgt werden, dieser Mehraufwand verursacht Kosten.
Hunde sind nicht uneingeschränkt empfehlenswert. Man muss Lust darauf haben, sie zu halten. Aufzwingen kann man sie niemandem. Natürlich sind alle Maßnahmen ein zeitlicher und geldlicher Mehraufwand, viele werden aber staatlich subventioniert. Für Zäune und Hunde gibt es in vielen Bundesländern eine volle Finanzierung.

Wie kann man Tierhalter*innen noch unterstützen?
Es gibt Initiativen, die Tierhalter*innen helfen, ihre Zäune aufzustellen und zu kontrollieren, weil diese Arbeitszeit noch nicht in allen Bundesländern subventioniert wird. Wichtig sind außerdem Schulungsangebote und Austauschformate mit Tierhalter*innen aus anderen Ländern, die schon länger an die Präsenz von Beutegreifern gewöhnt sind. In der Schweiz gibt es die Fachstelle Herdenschutz, die Einzelberatungen für Betriebe anbietet. Außerdem werden Risse aus entsprechend gesicherten Herden entschädigt.
Der Schäfer Frank Neumann aus Sachsen setzt seit Jahren Elektrozäune und Herdenschutzhunde zum Schutz vor Wölfen ein. Nachdem die Raubtiere einige Male gescheitert waren, griffen sie die Herden nicht mehr an. Seitdem betrachtet Neumann "seine" Wölfe als zusätzlichen Herdenschutz. Denn sie sind territorial und dulden keine fremden Artgenossen in ihrem Revier. Könnte das auch bei Braunbären funktionieren?
Frank Neumann hat die Wölfe mit seinen Herdenschutzmaßnahmen sozusagen trainiert. Der Angriff auf Nutztiere durch Bären ist aber deutlich seltener. Meist sind es einzelne Tiere, die damit schon einmal Erfolg hatten und es dann immer wieder versuchen. Von daher macht ein flächendeckender Herdenschutz gegen jede Art von Beutegreifern Sinn, denn je weniger Bären oder Wölfe diesen Lerneffekt erleben, desto besser.
Gibt es ähnliche Herausforderungen im Acker- und Obstbau?
Als primäre Vegetarier lieben Bären Früchte und suchen mitunter auch auf Obstplantagen nach Nahrung. In einem rumänischen Dorf wurden Obstbäume aus dem unmittelbaren Ortskern entfernt. Der Obstanbau wurde nach Außen verlagert, um die Bären nicht in den Ort zu locken.
Gerade im Alpenraum fürchtet man negative Auswirkungen auf den Tourismus. Ergeben sich durch die Anwesenheit von Bären auch wirtschaftliche Chancen?
Bären haben auf viele Menschen eine große Anziehungskraft. Bärentourismus gibt es zum Beispiel in Italien, Rumänien, Slowenien und Skandinavien. In Slowenien werden die Tiere in bestimmten Bereichen sogar angefüttert, damit Menschen sie leicht beobachten können. Das wird kontrovers diskutiert, aber ich halte es für vertretbar, weil es im Wald passiert und die Bären nicht gezielt zur Siedlung gelockt werden. Und touristische Angebote sind wichtig, um die Faszination für die Tiere zu fördern. Mit entsprechender staatlicher Unterstützung wäre sogar das Wiederaufleben traditioneller Berufsfelder denkbar. Hirten spielen in vielen Ländern mit großen Beutegreifern eine wichtige Rolle.
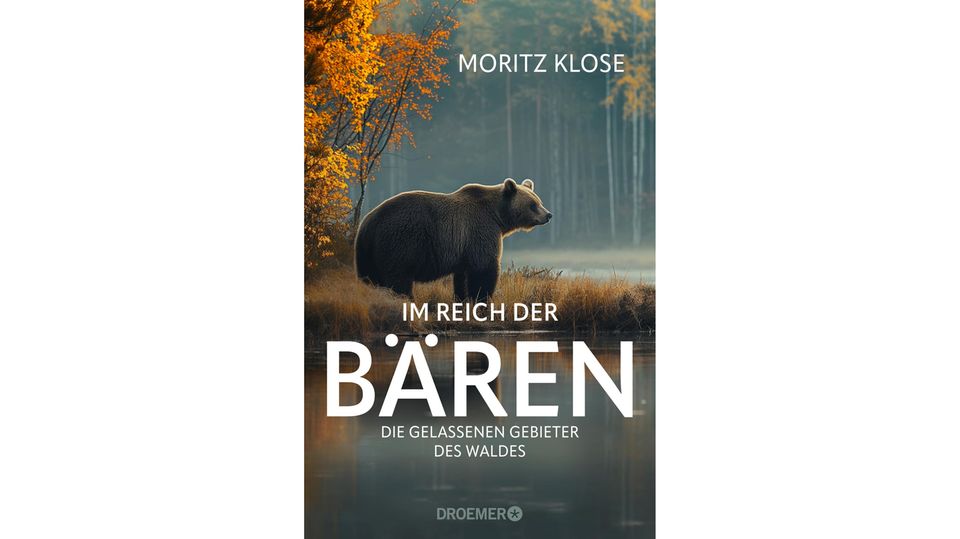
Gibt es in Deutschland genug Lebensräume für Braunbären?
Der Bär braucht Wälder und Rückzugsorte für den Winterschlaf. In einer reinen Kultur- oder Offenlandschaft würde er nicht zurechtkommen. Die Versiegelung der Landschaft und die Isolation einzelner Vorkommen sind ein Problem. Vor allem junge männliche Bären wandern weite Strecken, und wenn auf dem Weg Straßen oder Schienen sind, können sie zu Tode kommen. Zwar wären grundsätzlich alle waldreichen Mittelgebirge in Deutschland geeignetes Bärengebiet, aber da sie voneinander isoliert sind, erachte ich es nicht als realistisch, dass wir dort bald Bären haben. Doch einer Untersuchung zufolge gibt es im gesamten Ostalpenraum Platz für 1500 Bären – man geht dabei von ein bis zwei Bären pro 100 Quadratkilometer aus. Auch hier sind einzelne Gebiete durch Täler, Straßen und Siedlungen zerschnitten, aber damit kann der Bär zurechtkommen.
Sind wir bereit für die Rückkehr von Meister Petz?
Ich glaube, wir sind in einem Prozess, den ich in den letzten 15 Jahren auch beim Wolf beobachten konnte. Zuerst wollten die Menschen damit nichts zu tun haben, irgendwann sahen sie aber ein: Der Wolf gehört jetzt doch irgendwie dazu und bleibt hier. An diesem Wendepunkt befinden wir uns gerade. Es ist ein realistisches Szenario, dass große Raubtiere in unsere Nachbarschaft zurückkehren. Und ein ständiger Prozess, bei dem es niemals die eine Lösung gibt, die dann für immer funktioniert.


































