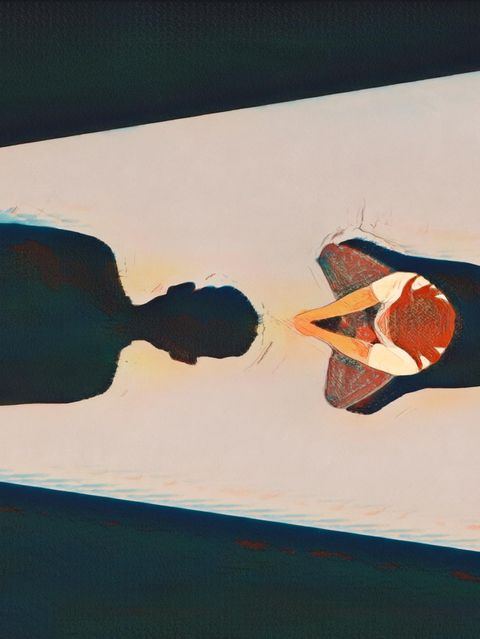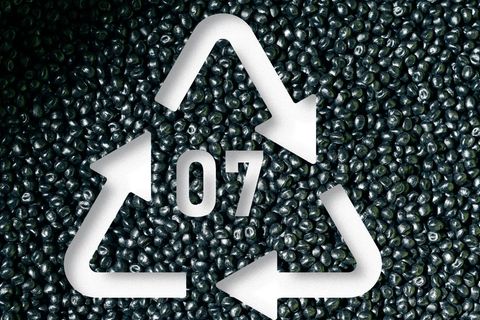Der Wind bläst kräftig aus Nordost, als die Reisegruppe aus dem Bus steigt. Haare flattern, Mützen werden fast vom Kopf gerissen. Die Touristen aus der Hauptstadt Taipeh spannen Regenschirme gegen die Sonne auf, werfen einen kurzen Blick auf das türkisfarbene Meer, das gegen eine mit struppigem Buschwerk bewachsene Felsenküste schlägt, und legen dann die Köpfe in den Nacken, um die eigentliche Attraktion zu würdigen: Windräder. Sechs Stück drehen sich hier, 60 Meter hoch die Masten, 44 Meter Flügelspannweite. Die Besucher posieren für Erinnerungsfotos.
Der Windpark von Zhongtun wäre in Deutschland keinen zweiten Blick wert, aber auf den Penghu-Inseln, zwischen Taiwan und Chinas Südostküste gelegen und auch als Pescadoren bekannt, gilt er als Touristenattraktion. Und das nicht nur, weil die aus Deutschland importierten Windräder als höchste Bauwerke der Inselgruppe viele Kilometer weit sichtbar sind. Sie stehen auch für das Versprechen auf ein neues, sauberes und grünes Taiwan. Die Energiewende hat nun auch diesen hochindustrialisierten ehemaligen Tigerstaat erreicht. Während die Umstellung auf Taiwan selbst noch zaghaft stattfindet, zeigen sich auf dieser vorgelagerten Inselgruppe Ansätze eines Asiens, in dem umweltfreundliche Technologie zum Alltag gehört - und das aufmerksam auch nach Deutschland blickt.

immer eine steife Brise
Mit gutem Beispiel voran
Einer von denen, die neuerdings davon profitieren, ist Chen Chi-ming. Das heiße Wasser für seine Familie liefert die Sonne, seit auf dem Dach eine Solarthermie-Anlage installiert ist. Mit Sonnenschein ist Penghu fast ebenso reich gesegnet wie mit Wind. "Das Wasser ist das ganze Jahr über so heiß, dass man sich daran verbrühen kann", sagt der 40-Jährige Angestellte. Etwa ein Drittel der Kosten von 1500 Euro hatte die Regierung übernommen. Entscheidend waren aber nicht die Subventionen, sagt Chen: "Als ich gesehen habe, dass meine Nachbarn eine Anlage haben, und dass sie funktioniert, wollte ich auch eine." Nun verbraucht er nur noch halb so viel Strom wie vorher und rät auch seinen Bekannten zur Umstellung.

auf dem Dach der Regionalregierung
Es ist noch nicht lange her, da galt Energiesparen in Taiwan als Fremdwort. Umweltschutz war kein Thema während des rasanten wirtschaftlichen Aufstiegs der siebziger und achtziger Jahre. Das Motto lautete Wachstum um jeden Preis, auf Kosten der Natur. Taiwans flache Westküste, wo sich mehr als 20 Millionen Menschen drängen, ist heute fast überall eine zersiedelte Stadt- und Industrielandschaft. Die Energie für die zahllosen Fabriken liefern vor allem Kohlekraftwerke. Eine Anlage im zentral gelegenen Taichung gilt als größter CO2-Emittent der Welt. Taiwans Großstädte litten noch um die Jahrtausendwende unter Verkehrsinfarkt, Luftverschmutzung und wilden Müllhalden. Doch vieles hat sich geändert, und Penghu mit seinen 90.000 Einwohnern soll Pilotbezirk und Aushängeschild für ein neues, grüneres Taiwan sein.
Elektrisch und leise summend ist auf den Inselstraßen die Zukunft schon unterwegs. Während sie sich auf Taiwan noch nicht durchgesetzt haben, fördert die Regierung auf Penghu Elektro-Motorroller. "Scooter" sind Taiwans Verkehrsmittel Nummer Eins, es gibt mehr Roller als PKW. Entsprechend groß ist der Benzinverbrauch. Das Land ist abhängig von importiertem Öl, und die Sorge, dass die Taiwan nicht freundlich gesinnte Volksrepublik China eines Tages den Nachschub abschneiden könnte, ist real. Höchste Zeit, sich nach Alternativen umzusehen.
Vier Stunden lang halten die Batterien der E-Scooter durch. Zeit genug, um kreuz und quer über Penghus mit Brücken verbundene Hauptinseln zu fahren. Das zeitraubende Aufladen entfällt auf typisch taiwanisch pragmatische Art: Jeder der zwei Dutzend über die Inseln verteilten Seven Eleven-Minisupermärkte tauscht den leergefahrenen Akku für gerade mal einen Euro gegen einen frisch geladenen. Die Regierung schießt beim Kauf eines E-Rollers die Hälfte des Preises von 1500 Euro dazu. Da Taiwan aber zugleich noch immer den Spritpreis künstlich niedrig hält - ein Liter kostet weniger als einen Euro - schreitet die Revolution nur langsam voran. Von Penghus 75.000 Motorrollern sind gerade mal 3600 elektrifiziert. 2015 sollen es 6000 sein. Dennoch könnte das Programm einen Effekt haben, denn die meisten E-Roller werden tageweise an Touristen vermietet. Fast 700.000 kommen Jahr für Jahr nach Penghu, zumeist gestresste Großstadt-Taiwaner auf der Suche nach Ruhe und Natur. Gingen sie mit dem Eindruck zurück, dass Elektrofahrzeuge eine echte Alternative sind, wäre schon viel gewonnen.

Science and Technology)
An Wandel sind Taiwaner gewöhnt. Zur gleichen Zeit, als ihr Lebensstandard sich vor Europa nicht mehr verstecken musste, geriet ihr Land wirtschaftlich ins Hintertreffen gegen China. Um die Jahrtausendwende wanderten viele schmutzige Fabriken ab in die billigere Volksrepublik. Die Zukunft Taiwans als Zentrum der globalen IT-Industrie liegt in Forschung und Entwicklung, nicht mehr in der Produktion. Ende der Neunziger mauserte das jahrzehntelang per Kriegsrecht regierte Land sich außerdem zur Demokratie. Mit Stimmrecht, wohlhabender und besser ausgebildet, fordert die breite Mittelschicht vernünftige Lebensbedingungen und bekommt sie auch.
Grünstrom statt Kohle und Öl
Wie in Deutschland liegt in der Stromproduktion der Schlüssel zur Umstellung der Wirtschaft. Taiwans Ziel muss es sein, genügend Energie zu erzeugen ohne immer mehr Kohle und Öl zu importieren. Mit dem Sparen tut man sich noch immer schwer. Fast überall laufen stromfressende Klimaanlagen im Dauerbetrieb, und vernünftige Isolierung ist auch bei Neubauten nicht vorgeschrieben. Bei der Stromproduktion aber beobachtet Taiwan sehr genau Deutschlands Energiewende-Erfahrungen und übernimmt Erfolg versprechende Modelle - auf Penghu besonders gut zu beobachten.

zugleich als Dach für den Motorroller-Parkplatz
Weil die Inseln mit Wind und Sonne reich gesegnet sind, wurden sie zum Pilotbezirk erklärt. Bis 2015 soll hier 55 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen stammen. Heute sind es in ganz Taiwan weniger als vier Prozent. Die Pläne umsetzen müssen Beamte wie Daniel Hung, Verwaltungschef der Regionalregierung. Aus den Statistiken und Powerpoint-Folien, die er in seinem Büro präsentiert, sticht eine Zahl hervor: Aus Penghus bislang 14 Windrädern sollen bis 2015 mehr als 100 werden. Mindestabstand zu bewohnten Häusern: gerade mal 300 Meter. Damit die Anwohner nicht auf die Barrikaden gehen, wird eine neue Betreibergesellschaft gegründet. An der können Bürger sich zu 30 Prozent beteiligen. "Man muss die Leute an Bord holen", sagt Hung. "Wer vom Gewinn profitiert, freut sich auch, wenn sich immer mehr Windräder drehen."
Nächster Schritt sind Offshore-Windfarmen. Die Niederlassung von Siemens in Taiwan hat bereits Interesse angemeldet, Windräder ins Meer der Taiwanstraße zu bauen. Ähnlich wie in Deutschlands Offshore-Hauptstadt Bremerhaven werden künftig gut ausgebildete Fachkräfte gebraucht. Die örtliche Hochschule hat bereits ein neues Institut für Forschung und Entwicklung gegründet. Vom solarbetriebenen Fahrrad bis zur Fischzucht mit Algenfütterung experimentieren 30 Studenten bei Professor Wu Wun-chin. Hinter dem Institutsgebäude drehen sich auf einem Testgelände 20 Windräder, ihre Leistung wird permanent vom Computer erfasst. Seit Jahrzehnten verlässt Penghus Nachwuchs für Studium und Arbeit die Heimat und zieht nach Taiwan. Wu hofft, dass der Trend sich nun umkehrt: "Meine Studenten sollen als Ingenieure auf Penghu bleiben und arbeiten."
Schattenspender zu Sonnenkraftwerken
Windkraft spielt die Schlüsselrolle, aber auch die Sonne wird genutzt. Vor dem Flughafen und am Hafenbecken der Inselhauptstadt Magong stehen neuerdings Dachkonstruktionen aus Solarpanelen, die zugleich Strom produzieren und Schatten spenden. Öffentliche Gebäude werden aufgerüstet: Wer mit Verwaltungschef Hung aufs Dach seines Bürogebäudes steigt, findet auch dort Solarzellen.
Im Winter, wenn der Wind stürmisch bläst, die Insulaner unter sich sind und keine Klimaanlagen laufen, soll Penghu bald mehr Energie produzieren als es verbraucht. Was noch fehlt, ist ein 60 Kilometer langes Kabel über den Meeresgrund nach Taiwan, um die überschüssige Energie dort ins Netz einzuspeisen. Die Pläne dafür liegen nicht nur bei Daniel Hung in der Schublade, sie sollen noch 2014 umgesetzt werden.
Hung hofft, dass die grünen Energien nun Penghu ein modernes Image geben, Arbeitsplätze schaffen und den Einheimischen neue Möglichkeiten öffnen. "Dass erneuerbare Energien uns Aufschwung bringen können", erinnert sich der Beamte, "das hätte früher doch kein Mensch geglaubt."