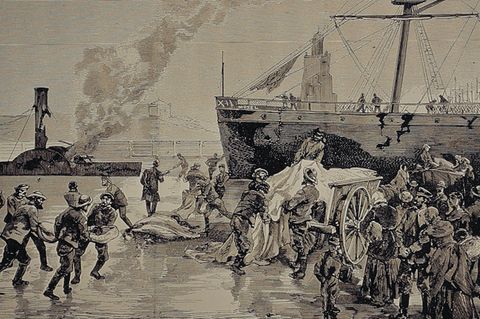GEO WISSEN: Frau Professor Perrig-Chiello, seit etwa 40 Jahren gibt es den Begriff der "Midlife-Krise" im allgemeinen Sprachgebrauch. Hat er überhaupt einen wissenschaftlichen Kern, oder ist er nur ein populäres Etikett für seltsame Verhaltensweisen von F
PASQUALINA PERRIG-CHIELLO: Es kommt darauf an, wen Sie fragen. Klinische Psychologen, die vor allem mit Menschen mit ernsthaften Problemen arbeiten, würden wohl sagen: Ja, so etwas wie eine Midlife-Krise gibt es tatsächlich. Fragen Sie dagegen Entwicklungspsychologen, die sich eher die Gesamtheit der Bevölkerung anschauen, werden die meisten wohl verneinen. Denn sie stellen fest, dass es sehr große individuelle Unterschiede gibt. Aus meiner persönlichen Sicht und aus meinen Forschungen kann ich sagen: Das mittlere Lebensalter ist eine absolut krisenanfällige Zeit, ähnlich wie die Pubertät oder die Pensionierung, die ja ebenfalls wichtige Übergangsphasen sind.

Wovon ist es abhängig, wie solche Phasen bewältigt werden?
Entscheidend sind die individuellen Persönlichkeitsfaktoren: Ein offener, aktiver Mensch, der sich vorausdenkend mit kommenden Veränderungen befasst, tut sich eher leicht damit, diese Veränderungen auch zu akzeptieren. Anders ist das bei Menschen, die viel Wert auf Routinen legen, die auf Sicherheit bedacht sind, die eher ängstlich und neurotisch sind: Die verlieren bei solchen Übergangsphasen schnell mal den Boden unter den Füßen. Das gilt auch für Menschen, die über Veränderungsprozesse nicht reden können oder wollen.
Gibt es da Geschlechtsunterschiede?
Frauen und Männer haben zwar gleichermaßen Probleme in der Lebensmitte, aber Frauen tauschen sich generell mehr mit anderen aus und kommen daher meist besser durch diese Zeit. So haben wir in einem unserer Forschungsprojekte gefragt: "Zu wem gehen Sie, wenn Sie ein großes persönliches Problem haben?" Die Männer haben dann unisono gesagt, fast vorwurfsvoll: "Selbstverständlich zu meiner Frau!" Sie sind extrem partnerzentriert; mit ihren Freunden reden sie zwar auch viel, allerdings über andere Themen wie etwa den Beruf oder ihre Hobbys, kaum aber über persönliche Angelegenheiten. Die Frauen dagegen haben auf die gleiche Frage geantwortet: "Ich gehe zu meiner Mutter, zu meiner Schwester, zu meiner Freundin..." Und erst dann kam der Mann als Ansprechpartner.
Welche Folgen haben diese Geschlechtsmuster?
Sie führen dazu, dass heftige Krisen der Lebensmitte häufiger bei Männern zu beobachten sind. Und die damit manchmal verbundenen radikalen Brüche: Manche geben von heute auf morgen den Job auf; andere gehen ins Kloster – oder verlassen sogar die Familie, gehen womöglich eine Beziehung mit einer jüngeren Partnerin ein. Männer machen in der Regel viel kompromisslosere Schritte als Frauen, weil sie zuvor mehr verdrängt, verschwiegen und verleugnet haben. Frauen flüchten weniger drastisch, sie holen sich eher Hilfe.
Man sollte meinen, die heute 40-Jährigen seien in einer ganz anderen Welt groß geworden als die Generation vor ihnen. Und sie würden auch einen anderen Kommunikationsstil pflegen.
Wir Forscher haben das auch gedacht, doch tatsächlich ist in Bezug auf den Umgang mit Problemen immer noch alles beim Alten. Frauen haben ihre breiten sozialen Netze, Männer dagegen wollen das meist mit sich selbst ausmachen oder allenfalls mit der Partnerin. Wir sehen das auch an der Suizidrate, die schnellt bei Männern ab etwa 60 bis 65 Jahren steil nach oben, während sie bei den Frauen über die Jahre fast stabil bleibt. Wenn Männer ihre Probleme nicht mehr mit Kraft oder Macht lösen können, ertränken sie ihre Sorgen häufiger als Frauen in Alkohol – und mitunter fällt ihnen dann kein anderer Ausweg ein, als sich der Situation durch Suizid zu entziehen.
Wie kommt es zu diesen Geschlechtsunterschieden?
Das liegt vor allem an der Sozialisation. Noch heute ist das nach außen gewendete Verhalten vor allem eine Sache der Jungen, sie lösen Konflikte eher mit Aggression, versuchen sich zu behaupten. Sie unterliegen einem deutlich stärkeren Geschlechterrollenstress als die Mädchen. Jungen müssen sich noch immer sehr männlich verhalten, Mädchen haben da größere Freiräume.
Kann einem der Lebensverlauf bis in die Lebensmitte einen Hinweis darauf geben, ob man in eine größere Krise gerät oder gut mit der Situation zurechtkommt?
Durchaus, denn unsere Studien zeigen, dass Menschen, die auch zu früheren Zeitpunkten Probleme mit biographischen Übergängen gehabt haben, also etwa in der Pubertät oder mit dem Berufseintritt, oft von einer zur nächsten Krise stolpern. Wir sprechen von einem "self-made disaster". Das Erstaunliche daran ist, dass die Betreffenden offenbar nur wenig daraus lernen. Sie fallen immer wieder in falsche Bewältigungsmuster zurück.
Und das lässt sich nicht verhindern?
Doch, aber dazu bedarf es besonderer Ereignisse. Das kann die Begegnung mit einem Menschen sein, der einem neue Perspektiven eröffnet. Oder in einer schweren Krise die Einsicht, dass man nun psychologische Hilfe braucht.
Muss das eine professionelle Therapie sein?
Nicht unbedingt. Letztlich hilft jede Beratung, die einen dazu motiviert, einmal innezuhalten, die einem Verhaltensmuster aufzeigt und neue Perspektiven anbietet. Entscheidend ist: Man muss entdecken, dass man nicht nur ein Spielball der Umstände und der eigenen Biographie ist, sondern eine Selbstverantwortlichkeit hat und die auch wahrnehmen kann. Ich habe in vielen Projekten gearbeitet, in denen wir nach den Voraussetzungen für Wohlbefinden und Gesundheit gesucht haben, wir haben das Rauchen untersucht, das Essverhalten und anderes. Am Ende war die stärkste Determinante die Selbstverantwortlichkeit – also die Einsicht, dass man größtenteils selbst für seinen Lebensweg und seine Befindlichkeit verantwortlich ist. Und man nicht die Eltern, den Partner, die Gesellschaft oder das Schicksal dafür verantwortlich machen kann.

Bis dahin muss man aber möglicherweise einige Desillusionierungen durchleben, sich von alten Träumen verabschieden.
Das Aufgeben von Illusionen gehört zum mittleren Lebensalter. Wer nie desillusioniert wurde, hat auch nie die Chance, durchzustarten und etwas Neues zu wagen. Der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung hat gesagt, man könne die zweite Lebenshälfte nicht nach dem Muster der ersten leben. Viele Menschen begreifen das nur durch eine Krise – die sehr schmerzhaft sein kann, aber auch sehr heilsam.
Man muss durch ein tiefes Tal gehen, damit es einem nachher besser geht?
Gewissermaßen ja. Wir wissen aus länderübergreifenden Studien, dass diese Talsohle ein fast universelles Phänomen ist. In 80 Ländern hat man Befragungen gemacht, etwa in den Industriestaaten, aber auch in Simbabwe und Mexiko. Immer wieder stellt sich heraus, dass die Kurve der empfundenen Lebenszufriedenheit u-förmig verläuft. Sie hat einen Tiefpunkt in den mittleren Jahren, in Europa etwa bei 46 Jahren, in Schwellenländern bei 43 Jahren, danach aber steigt sie wieder an. Mit zunehmendem Alter nimmt dann auch das Wohlbefinden wieder zu. Die Leute sind nun krisenerprobt und gelassener, kurzum: Die meisten haben die Lektionen des Lebens gelernt. Man kann das Lebenserfahrung oder Reife nennen.
Was ist aus Ihrer Sicht das Charakteristische an der Lebensmitte?
Viele Menschen stellen rund um den 40. Geburtstag die ersten Zeichen des Alterns an sich fest. Zudem sind die Kinder in einer problematischen Phase, die Eltern werden alt und hilfsbedürftig, und viele fühlen sich wie in einem Hamsterrad. Man wird sich der eigenen Endlichkeit bewusst, fragt sich, was habe ich erreicht, was will ich noch erreichen, zieht also Bilanz. Man zählt nicht mehr die Jahre nach der Geburt, sondern schaut eher auf die Zahl der Jahre, die wohl noch vor einem liegen. Wenn Frauen in diesem Alter noch keine Kinder haben, müssen sie sich damit auseinandersetzen, dass sie wahrscheinlich kinderlos bleiben werden. Männer fragen sich, ob es beruflich nun noch Jahrzehnte so weitergehen soll, sie bleiben in Sackgassen stecken, werden vielleicht von Jüngeren überholt. Es ist daher auch eine Phase der Neudefinition des Lebens, der Übernahme neuer Rollen, eben ein Übergang in die zweite Lebenshälfte.
Ist das Hamsterrad-Gefühl einer der Gründe dafür, dass in der Lebensmitte auch die Fälle von Burnout-Syndrom zunehmen?
Dieses Permanent-am-Limit-Sein ist tatsächlich ein Kennzeichen der Lebensmitte – aber ob man dem gleich ein Krankheitsetikett verpassen muss, ist eine andere Frage.
Woran fehlt es Frauen und Männern in dieser Zeit am meisten?
Wir haben in einer Studie eine sehr starke Diskrepanz festgestellt zwischen den Zeitbudgets, die Menschen für Beruf, Partner, Kinder und Freizeit investieren müssen – und dem, was sie eigentlich wollen. Viele wünschen sich, weniger Zeit für den Beruf aufzuwenden und mehr Zeit für die Partnerschaft. Aber das eindrücklichste Ergebnis war, dass sich fast alle wünschen, mehr Zeit für sich selber zu haben.
Bei Frauen und Männern gleichermaßen?
Durchaus, allerdings mit einem Unterschied: Die meisten Männer möchten auch mehr Zeit für die Kinder haben, die Frauen eher weniger, dafür aber mehr Zeit für den Beruf. Das gilt übrigens für Alleinerziehende ebenso wie für verheiratete Frauen, die berufstätig sind oder waren. Praktisch alle Frauen gaben an, dass die Mutterrolle sie zeitlich weitaus mehr beansprucht hatte, als ihnen eigentlich lieb war.
Und am Ende sind sie mehr als ihre Männer erleichtert, wenn die Kinder aus dem Haus sind?
Solange die Kinder noch daheim wohnen, sehen sowohl Männer als auch Frauen den bevorstehenden Auszug vor allem positiv. Befragt man die Eltern aber nach dem Auszug, so zeigt sich, dass die Väter den Auszug deutlich ambivalenter sehen, sogar eher negativ. Die Frauen sind oft froh, dass sie den Nachwuchs endlich loslassen können. Die Männer haben sich dagegen oft völlig verschätzt, sie sind häufig tief betrübt über den Auszug der Kinder. Denn sie haben den Eindruck, etwas verpasst zu haben: Sie haben alles für den Beruf gegeben, hätten aber gern mehr mit den Söhnen oder Töchtern gemacht – und dann ist es plötzlich zu spät.
Und wenn die Kinder nun aus dem Haus sind...
...sind es trotzdem immer noch die Frauen, die den Kontakt halten, sei es durch Telefon oder SMS oder durch die dreckige Wäsche, die der Nachwuchs nach Hause trägt.
Erstaunlich – jetzt müssten doch vor allem die Männer den Impuls haben, die Bande zu erhalten.
Ja, aber es gelingt offenbar nur wenigen, die alten Muster tatsächlich zu durchbrechen. Und wenn, dann eher in neuen Beziehungen: Männer, die in der Lebensmitte noch einmal Kinder mit einer jüngeren Partnerin haben, präsentieren sich oft als ganz andere Väter, haben viel mehr Zeit für die Kinder. Das liegt nicht nur an den Erwartungen der Frauen, sondern ist auch ein Kompensationsverhalten der Männer.
Wie passt der Wunsch von Männern und Frauen in der Lebensmitte nach mehr Zeit für sich selbst mit der Erkenntnis von Entwicklungspsychologen zusammen, die darauf hinweisen, wie wichtig es ist, in dieser Phase auch Verantwortung für die Gesellschaft zu übe
Der deutsch-amerikanische Psychologe Erik H. Erikson hat davon gesprochen, dass Menschen in der Lebensmitte vor der Entscheidung zwischen "Generativität und Stagnation" stehen. Vor der Frage, ob sich alles nur um das eigene Ich drehen soll, was nach Erikson dazu führt, dass man in seiner Entwicklung stagniert – und am Ende Sinnleere spürt. Oder ob man ein Bedürfnis entwickelt, Werte für die kommende Generation zu schaffen und weiterzugeben – was, so Erikson, in der Regel als Bereicherung der eigenen Persönlichkeit empfunden wird. Ich sehe das eine Nuance anders: mehr Zeit für sich und ein Engagement für die Gesellschaft schließen sich nicht unbedingt aus. Denn nur wer die Zeit dafür hat, in sich zu gehen, kann etwa feststellen, dass die Fixierung beispielsweise auf den Beruf ihn nicht weiterführt, sondern stagnieren lässt. Viele Menschen kommen durch das Innehalten überhaupt erst auf die Idee, sich auch für andere einzusetzen – etwa wenn sie sich die Frage stellen, welche Spuren im Leben sie hinterlassen können, auch wenn sie keine Kinder haben.

Diese Ichbezogenheit in der Lebensmitte wäre demnach eher eine Durchgangsstation?
So ist es. Ich würde das als "Radikalität des Nullpunkts" bezeichnen. Man braucht diese Konzentration auf sich selbst, um danach wieder offen für Neues zu sein.
Erhöht das dann tatsächlich die Lebenszufriedenheit?
Da bin ich mir sehr sicher. Bislang ist das Thema Lebenszufriedenheit und Glück vor allem mit Religiosität und Spiritualität in Verbindung gebracht worden. Aber auch die Generativität, der Einsatz für die kommende Generation, hat dieses Potenzial. Dabei hat dieser Einsatz für andere zweifellos auch eine starke egozentrische Komponente. Im Grunde ist es purer Egoismus, dass wir uns generativ verhalten.
Wer anderen hilft, hilft auch sich selbst?
Ganz genau. Wer anderen hilft, dem geht es selber gut. Und wer das begriffen hat, der macht das auch für sich selbst.
Spiegelt sich diese Erkenntnis auch darin, dass die Großelternschaft – wie Sie herausgefunden haben – heutzutage eine derart extrem positive emotionale Bewertung erfährt? Obwohl man ja sagen könnte, wer in der Lebensmitte Opa oder Oma wird, der weiß wirkl
Die Großelternschaft hat sehr viel mit Generativität zu tun, sie wird als ähnlich emotional positiv bewertet wie die eigene Heirat und die Geburt des ersten Kindes – und positiver als der erste Job oder die erste Liebe. Die Lebensmitte bietet ohnehin eine große Chance, neue Rollenmuster auszuprobieren, etwa auch dadurch, dass Männer ihre weiblichen Seiten entdecken und Frauen ihre männlichen.
Das müssen Sie bitte erklären.
Die Geschlechter bewegen sich aufeinander zu. Zuvor, in der Phase der Reproduktion, zeichnen sich Männer in der Regel durch eine ausgeprägt maskuline Geschlechtsrollenorientierung aus, Frauen geben sich besonders feminin; beide erfüllen damit geschlechtstypische Erwartungen. In der Lebensmitte kommt es dann beim Mann zum allmählichen Absinken des Testosteronspiegels, bei der Frau geht der Östrogenspiegel in der Menopause stark zurück. Diese biologischen Veränderungen modifizieren auch die Psyche und das Verhalten.
Was genau bedeutet das für Mann und Frau?
Eine Frau bekommt etwa eine tiefere Stimme, und die Taille schwindet. Oft entdeckt sie in dem Zuge ihre hartnäckigen und kantigen Seiten und ihre Durchsetzungsfähigkeit, ist entschlossener im Auftreten und weiß besser, was ihr guttut und was nicht – alles Verhaltensweisen, die man landläufig eher einem Mann zubilligen würde. Beim Mann erhöht sich die Stimmlage, es kommt zu Fettpolstern an der Brust und er entdeckt verstärkt vermeintlich feminine Eigenschaften wie Sensibilität, Zärtlichkeit und Passivität.
Das klingt so, als ob sich beide Geschlechter hin zu einem Neutrum entwickeln.
So ist es nicht. Sie können nun vielmehr beide Anteile in sich bewusster zulassen und ausleben, ohne dafür sanktioniert zu werden. Das ist eher eine Art neuer Freiheit, unterdrückte Anteile des Ichs zu entdecken, sich den Zwängen der klassischen Rollenzuteilung zu entziehen. Für viele Kulturen ist inzwischen dokumentiert, dass sich bei Menschen ab der Lebensmitte substanzielle Veränderungen anbahnen. Ältere Männer etwa beschreiben sich oft als sensibler gegenüber sozialen Aspekten des Zusammenlebens als zuvor, als sie noch auf die Rolle des Ernährers festgelegt waren. Und eine europäische Langzeitstudie hat gezeigt, dass eine solche neue Rollenorientierung die Anpassung an das Älterwerden erleichtert. So wird eine Frau, die immer nur dem Weiblichkeitsideal entsprechen will, schnell frustriert sein. Denn ihr jugendliches Aussehen kann sie sich nun mal nicht ewig bewahren. Und wenn ein Mann von 60 nur Macho sein will und ständig seine Potenz auf verschiedenen Gebieten zur Schau stellt, dann wirkt das lächerlich. Auf die Lebenserwartung wirkt sich so ein Verhalten ohnehin nicht positiv aus.
Wieso?
Im Rahmen verschiedener Langzeitstudien hat sich gezeigt, dass Männer, die besonders um die Erhaltung und Ausweitung sozialer Kontakte bemüht waren und eher von Gefühlen der inneren Verbundenheit mit anderen und zwischenmenschlichem Vertrauen berichteten, im Durchschnitt länger lebten als jene Männer, die in ihren traditionellen Normen verharrten. Stark macht Männer und Frauen im mittleren Alter, wenn sie über möglichst viele Bewältigungsstrategien verfügen, über männliche und weibliche, weiche und harte.
Hatten Menschen früherer Jahrhunderte eigentlich auch eine krisenhafte Zeit in der Lebensmitte?
Die Lebenserwartung war in jener Zeit deutlich kürzer, noch vor 100 Jahren wurde man in Mitteleuropa im Schnitt nur 48 Jahre alt. Dennoch gab es eine Menge Leute, die sehr viel länger lebten und sehr wohl so etwas wie eine Midlife-Krise hatten. Der italienische Dichter Dante Alighieri hat ungemein plastisch in seiner "Göttlichen Komödie" beschrieben, durch was für eine Hölle er dabei gegangen ist. Und schon im 14. Jahrhundert hat der Mystiker Johannes Tauler sehr treffend über die spirituelle Krise in der Lebensmitte geschrieben, von ihm stammt übrigens der Begriff "Radikalität des Nullpunkts". Man habe verschiedene Facetten des Lebens ausgelebt und stehe nun vor der Frage: Und wie weiter jetzt? Durch Reflexion, Meditation und Läuterung könne man dazu kommen, eine neue Perspektive zu finden. Das klingt geradezu modern!
Was halten Sie von den Versuchen, das Altern aufzuhalten, etwa durch chirurgische Eingriffe?
Das ist ein altersunabhängiges Phänomen, das viel früher einsetzt als in der Lebensmitte. Schon 25-jährige Frauen lassen sich ja inzwischen mit Botox behandeln. Aber so etwas dient sicher nicht der Erleichterung des Älterwerdens. Es verhindert eher, dass wir akzeptieren können: Unser Körper verändert sich – und auch die Lebensperspektive. Es ist so etwas wie der Versuch, sich über das Älterwerden hinwegzuschummeln.
Gilt das inzwischen für beide Geschlechter gleichermaßen?
Frauen versuchen vor allem ihr Äußeres zu beeinflussen, während Männer die besten Klienten von hormonellen Anti-Aging- Angeboten sind, weil ihnen vor allem die Leistungsfähigkeit so wichtig ist. Aber man darf nicht vergessen, dass der Wunsch nach ewiger Jugend, nach Schönheit und Potenz ein uralter Menschheitstraum ist. Und heute haben wir schlicht mehr Möglichkeiten, ihm ein klein wenig näher zu kommen.
Hinzu kommt oft, dass auch die Kleidung der 40- und 50-Jährigen mitunter ausdrückt, dass man noch immer so wirken will wie die halb erwachsenen Kinder.
Da tut mir vor allem die nachfolgende Generation leid. Denn nichts stört junge Leute mehr, als wenn ihre Generationenidentität nicht respektiert wird – wenn die Älteren also versuchen, die Grenzen zu verwischen, ob nun durch ihre Kleidung oder ihren Jargon. So etwas ist Gift für die Beziehung der Generationen untereinander. Ich glaube auch nicht, dass diese Menschen glücklich mit ihrem Lebensalter sind, denn sie verleugnen es ja eindeutig und versuchen, sich eine Identität anzueignen, die Jüngeren zusteht.
Diese Menschen sind nicht mehr sie selbst, sie wollen jemand anderes sein?
Ja – aber sie suchen nicht etwa eine eigene Identität, sondern übernehmen Versatzstücke anderer Identitäten. Dabei wird uns in der Lebensmitte doch gerade die Chance gegeben, eigene Standards zu entwickeln. Wenn Sie die Lebensläufe von sehr alten, glücklich gealterten Menschen analysieren, dann stellen Sie immer wieder eines fest: Es sind in der Regel Männer und Frauen, die oft in der Lebensmitte gelernt haben, sich frei zu machen von dem, was andere sagen oder was gerade Mode ist. Sie sind selbstbestimmt und selbstwirksam ihren eigenen Weg gegangen. Das ist eine der großen Chancen, die wir in der Lebensmitte haben. In der Aufbauphase des Lebens müssen wir noch viele Kompromisse machen. In der zweiten Lebenshälfte dagegen nicht mehr so viele.
Haben solche Erkenntnisse auch bei Ihnen persönlich zu Veränderungen geführt?
Ich habe mein Leben im Alter von 40 Jahren radikal verändert. Ich hatte sehr früh Karriere gemacht, mit 28 den Doktortitel erworben, dazu zwei Kinder bekommen, alles im Schnelltempo. Im Anschluss kam eine therapeutische Ausbildung. Ich habe dann eine Praxis aufgemacht und an Schulen für Sozialarbeiter unterrichtet. Irgendwann habe ich mich die immer gleichen blöden Witze im Unterricht erzählen hören. Zudem empfand ich die Probleme der Patienten in den Therapiesitzungen als sehr belastend. Mir wurde klar, das kann ich nicht 20 oder 30 Jahre lang so weitermachen. Hinzu kam ein Bandscheibenvorfall, der mich einen Monat in die Waagerechte zwang. Da hatte ich viel Zeit, in mich zu gehen. Ich habe beschlossen, zu habilitieren und an eine Universität zurückzugehen. Und plötzlich bekam ich die Gelegenheit. Das war spät, mit 40, aber ich wusste, dass ich genau das wollte.
Das klingt aber doch eher nach einer klassischen akademischen Karriere – erst die Doktorarbeit, dann die Habilitation. Wo war da der Bruch?
Von außen gesehen mag das so erscheinen, doch ich habe es nicht so empfunden, denn ich strebte keine Professur an, sondern wollte therapeutisch arbeiten. Heute kümmere ich mich vor allem um Dinge, die mir als Wissenschaftlerin am Herzen liegen, das ist etwas ganz anderes. Ich denke, ich habe zum richtigen Zeitpunkt die richtige Option genutzt. Und ich bin übertzeugt davon, dass jemand, der alert ist, wach und offen dem Leben gegenüber, immer die eine oder andere Gelegenheit finden wird, sein Leben neu auszurichten.