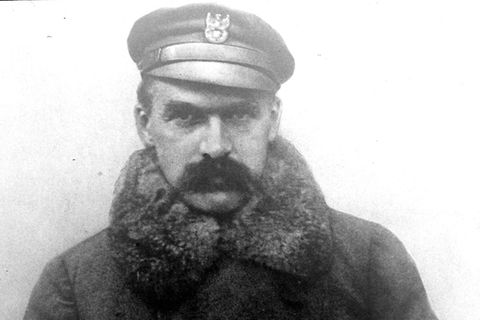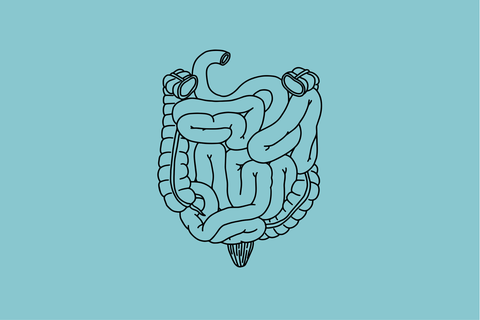(ca. 1900)
Ein Text von Harald Eggebrecht Bei den Indianern bildeten die Frauen die Basis der Familie, sorgten für deren Zusammenhalt und bewahrten die kulturelle Tradition des Volkes. Sie bestimmten Einteilung und Erledigung ihrer Arbeiten selber und redeten mit in den politischen Belangen der ganzen Gruppe - mochten diese nun unter den Bedingungen der Wälder nördlich der Großen Seen leben wie die Ojibwa oder in den Wüsten des Südwestens wie die Apache, in den Langhäusern der Irokesen-Stämme im Nordosten oder in den Subtropen von Florida wie die Seminole.
Insgesamt herrschte auf dem riesigen Kontinent, je nach Volk und Lebensumständen unterschiedlich, ein fein austariertes Verhältnis zwischen der Männer- und der Frauenwelt, die gleichwohl deutlich voneinander getrennt waren. Männer suchten normalerweise die Gesellschaft ihrer Geschlechtsgenossen. Ebenso benahmen sich die Frauen. Selbst gegessen wurde bei manchen Stämmen separat.
Der Mann hatte für Jagdbeute und Schutz zu sorgen, die Frau den Haushalt zu organisieren. Bei den Stämmen der Großen Ebenen zerlegten Frauen die Bisons, präparierten die Häute, aus denen sie die Tipis zuschnitten und Kleider sowie Mokassins fertigten. Bei den Navajo schoren sie die Schafe, die ihnen gehörten, versponnen die Wolle und webten Decken und Teppiche daraus.
Trotz des unablässigen Arbeitsdrucks fanden die Frauen Zeit für Sport - etwa Schwimmen, Reiten oder Lacrosse, ein Spiel, das dem Hockey ähnelt und bei vielen Völkern des Ostens sehr beliebt war. Manche Frauen verfielen dem Würfel- und anderen Glücksspielen so sehr, dass sie ihre Kleider, ihren Schmuck und sogar ihren Hausrat verwetteten.
Das Frauendasein begann mit dem Einsetzen der Periode. Schon während der Kindheit - bei den Indianern wurden Heranwachsende nicht geschlagen - führten die Erwachsenen ihren Nachwuchs behutsam an dessen späteren Aufgaben heran, begleiteten die Mädchen ihre Mütter, Tanten und Schwestern beim Beerensammeln, Wurzelngraben, Wasser- und Brennholzholen.
Mit der ersten Menstruation wurde es ernst. Wegen der als gefährlich eingeschätzten Kräfte seines Blutes hatte das Mädchen sich abzusondern: Es zog sich in eine kleine Hütte außerhalb des Dorfes oder in ein eigenes Zelt zurück. Danach galt das Mädchen als Frau.
Bei einer Heirat waren Zuneigung und Liebe der Partner zueinander nicht notwendig. Eltern oder auch Brüder beeilten sich - schon wegen des verbreiteten Prinzips der vorehelichen Keuschheit -, die Tochter oder Schwester rasch zu vermählen. Häufig verabredeten Familien schon frühzeitig Ehen, die darauf abzielten, Besitz, Sicherheit und gesellschaftliche Reputation auf beiden Seiten zu mehren.

Der voreheliche Umgang der Geschlechter miteinander variierte stark unter den Völkern. So prahlten Huronenmädchen geradezu mit der Zahl ihrer Liebhaber, ebenso die Natchez am unteren Mississippi. Die Apache hielten dagegen auf strenge Moral, bei ihnen gab es "Anstandsdamen", die die Jungfrauen im Auge behielten und jeglichen Kontakt zu jungen Männern unterbanden.
Bei manchen Völker war jungen Unverheirateten sogar das Reden mit Männern verboten. Zu Scheidungen kam es häufig - wohl weil viele der vorab arrangierten Ehen missrieten. Wohnte die Indianerin mit ihrem Gatten bei der Familie ihrer Mutter, brauchte sie oft nur dessen Siebensachen vor die Tür zu stellen, um ihn loszuwerden. Danach konnte sie erneut heiraten. Wohnte sie bei der Familie ihres Mannes, konnte sie dessen Behausung verlassen, womöglich mit den Kindern, und zu ihren Eltern zurückkehren.
Den Eheschließungen gingen Werbungen voraus; häufig musste ein Brautpreis gezahlt werden. Je höher dieser war, umso größer die Ehre für sie und ihre Verwandten. Mancher Häuptling oder besonders gute Jäger hatte mehrere Frauen, doch waren dem männlichen Egoismus bei solcher Polygamie Grenzen gesetzt: Die Erstfrau musste zuvor um Erlaubnis gebeten werden, diese blieb Chefin des Hauses und tat sich mit der Zustimmung oft leicht, weil nun die Hausarbeit auf mehrere Arme verteilt werden konnte.
Alle Indianerinnen waren religiös und spirituell geprägt. Bei den Navajo sahen sie sich als "Töchter der Spinnenfrau" - als Erbinnen der Kunst jener Göttin, die das Spinnen und Weben in die Welt gebracht hat. Während die Zeremonialtänze der Männer Jagd- und Kriegsglück beschworen, dienten die Rituale der Frauen und ihrer geheimen Gesellschaften der Fruchtbarkeit des Bodens und der Sorge um die Ernährung.

Die "Weiße-Bisonkuh-Frauen" bei den Mandan und Hidatsa in den Großen Ebenen suchten mit rituellen Tänzen, die Bisonherden anzulocken. Dabei ahmten sie unter Masken die Bewegungen der Herdentiere nach. Und die "Gansgesellschaft" zelebrierte Rituale, die das Gedeihen von Getreide und Früchten fördern sollten.
Bei den Irokesen und anderen Völkern des Nordostens hatten die Frauen, über die stets die Namens- und Erbschaftslinien liefen, Einfluss auf alle sozialen und politischen Entscheidungen. 1724 schrieb der französische Jesuitenpater Joseph F. Lafitau: "Nichts jedoch ist wirklicher als die Überlegenheit der Frauen. Sie bilden eigentlich die Nation; nur durch sie finden Blutsadel, Stammbaum und Familie ihre Kontinuität. Bei ihnen liegt alle wahre Autorität. Das Land, die Felder und die Ernten gehören ihnen. Sie sind die Seelen der Ratsversammlung, Schiedsrichterinnen in Krieg und Frieden. Sie verfügen über den öffentlichen Schatz. Ihnen werden die Sklaven zugeteilt."
Im traditionellen Langhaus herrschten die Matronen; sie konnten die Häuptlinge bestimmen. Versagte einer, wurde er nach mehrfacher Verwarnung abgesetzt. Zu den Ratsversammlungen waren die Frauen zwar nicht zugelassen, doch nahmen sie indirekt Einfluss - durch einen von ihnen gewählten Sprecher. Da sie die wirtschaftlichen Verhältnisse des Stammes bis zur Verteilung der Lebensmittel einschließlich der von den Männern erjagten und gefischten Tiere zu organisieren hatten, auch den Proviant für Kriegszüge, konnten sie die Austeilung von Mais und Mokassins verweigern, wenn sie gegen einen Krieg waren.
Die Menopause bedeutete die Befreiung von Schwangerschaft, Kindererziehung und Menstruationstabus. Jetzt konnten manche Frauen "Medizinfrau" werden, denn die Heilkräfte der Pflanzen konnten nun nicht mehr durch ihre Monatsblutungen als gefährdet gelten. Ältere Frauen trugen auch die Verantwortung für die Trauerfeiern. Sie waren zuständig für Klagegeschrei und Gesänge, besuchten die Gräber und sonstigen Bestattungsorte.
Wenn die letzte Stunde einer Indianerin nahte, wurde sie in vielen Stämmen angekleidet, bemalt und sogar bereits zur Bestattung hergerichtet. Sie starb nicht allein. Bei den Omaha ermutigten die Trauernden die Sterbende auf ihrem Pfad ins Jenseits: "Du stehst im Begriff, zu den Bisons zu gehen. Du wirst zu unseren Vorfahren heimkehren. Du wirst zu den vier Winden gehen. Sei stark!" Dann wurde sie begraben; oft tötete man ihr Lieblingspferd und hängte den Schweif am Grab auf.
Die Chocktaw im Süden legten die Leiche auf ein Totengerüst. Nachdem dann der Leichnam verwest war, rief man die Knochensammler, die mit ihren Fingernägeln die Gebeine säuberten und dann herabreichten. Das Gerüst und sonstige Relikte wurden verbrannt, die Knochen in einen Sarg gelegt und in einem Beinhaus beigesetzt.
Die Lebensbahnen der Frauen waren gesellschaftlich fixiert, und doch wurden sie häufig durchbrochen. Wer einen Weißen heiratete - der Stammesdiplomatie halber, vielleicht auch aus Liebe - und diese besondere Stellung zur Vermittlung zwischen den Kulturen nutzte, konnte auf beiden Seiten geachtet und berühmt werden, etwa die Creek Cousaponokeesa (die Weißen nannten sie Mary Musgrove), die Mohawk Degonwadonti (Molly Brant), oder die Cherokee Nanyehi (Nancy Ward).
Manche Frauen stießen sogar in klassische Männerdomänen vor, gingen auf die Jagd oder zogen in den Krieg. Bei den Ojibwa etwa griffen die Frauen, wenn der Mann krank, faul, abwesend oder tot war, selbst zur Jagdwaffe; schon junge Mädchen begleiteten ihre Väter auf der Pirsch.
Bei den Sioux nahmen manche Frauen an der Bisonjagd teil, nahmen aktiv am Krieg teil, töteten und skalpierten sogar Feinde. Bei den Cherokee wurden Kriegerinnen in einen Frauenrat gewählt, konnten über Krieg und Frieden mitreden und über das Schicksal von Gefangenen mitbestimmen. Und Lozen, die Schwester eines berühmten Anführers der Chiricahua-Apache, galt als beste Reiterin, Lassowerferin und Pferderäuberin ihres Stammes; sie wurde als Späherin ausgeschickt und als talentierte Strategin mit zum Kriegsrat gebeten.
Durch den Siegeszug des Weißen Mannes verloren die indianischen Völker mit ihrem Land, den Bisons, den Begräbnisstätten schließlich auch ihre soziale Identität. Alkoholismus, Arbeitslosigkeit und Kriminalität grassierten unter den einstigen Kriegern. Anders bei den Frauen: Sie mussten weiter den Haushalt führen, die Kinder aufziehen, ihre Familie zusammenhalten. Deshalb gelten gerade sie heute als das Gedächtnis der indianischen Welt.