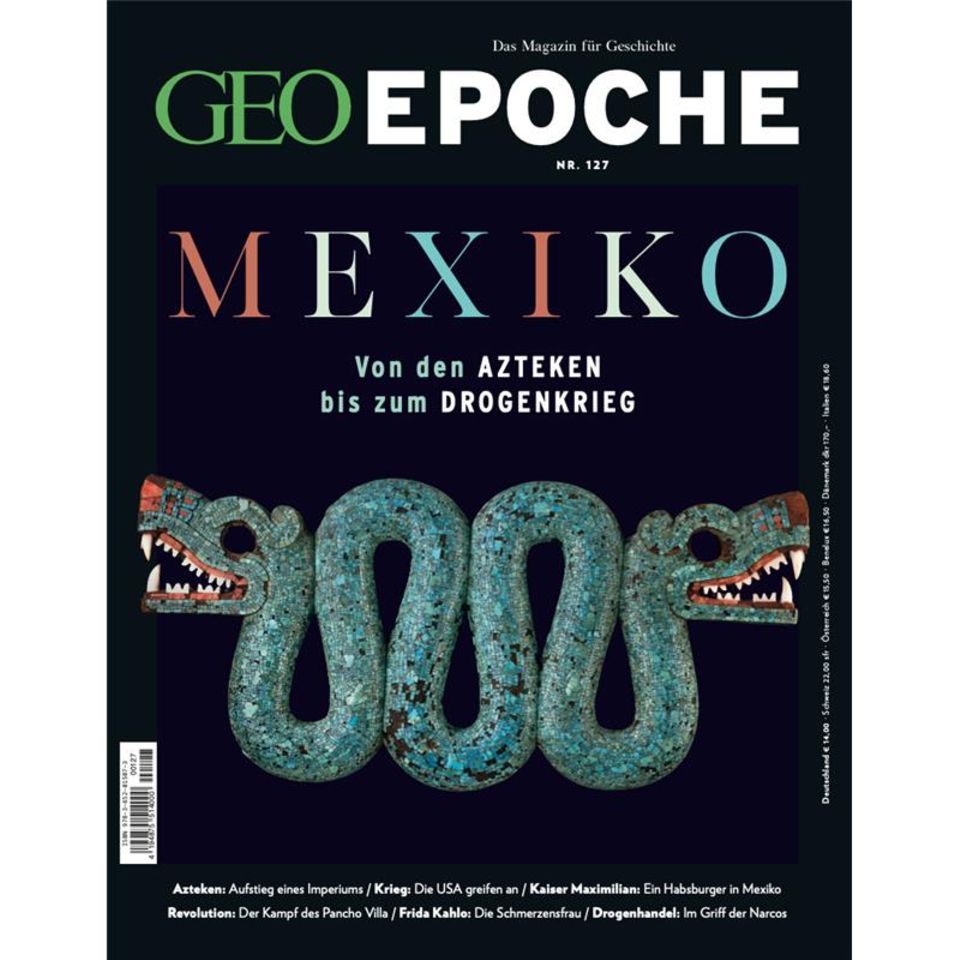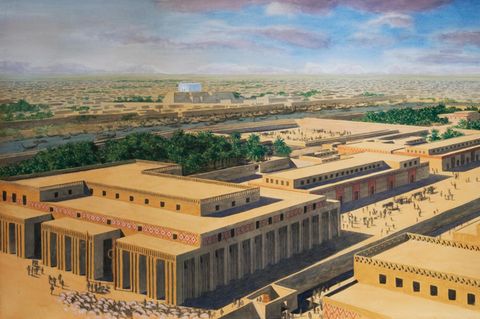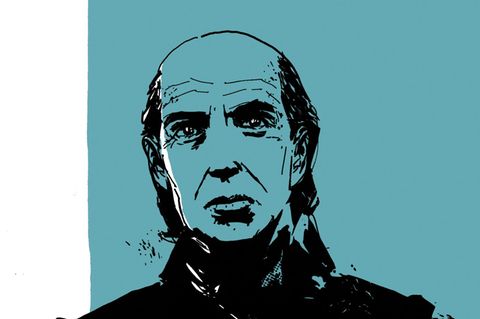GEOEPOCHE: Herr Professor Piccato, Sie schreiben in einem Ihrer Bücher, Mexikos Gegenwart sei geprägt von "Gewalt und Straflosigkeit in einem solchen Ausmaß, dass der Name des Landes förmlich zum Synonym für Schande geworden ist". Droht Mexiko, zu einem gescheiterten Staat zu werden?
Prof. Pablo Piccato: Nein, so weit würde ich nicht gehen. In einem gescheiterten Staat funktionieren die Institutionen überhaupt nicht mehr, hat das organisierte Verbrechen die Macht übernommen. In Mexiko gibt es aber mehr oder weniger gut funktionierende Institutionen, das Gesundheitssystem etwa, das Wahlsystem. Für das Justizsystem gilt das indes nur mit großen Abstrichen. Etwa 85 Prozent der Beschwerden, die an Ermittlungs- und Justizbehörden herangetragen werden, werden gar nicht untersucht. Was man sagen muss: Mexikos Gesellschaft ist sehr stark von Gewalt betroffen.
Haben Sie persönlich Gewalt erlebt?
Als Jugendlicher in den 1980er Jahren in Mexiko-Stadt haben mir Polizisten auf der Straße meine Uhr weggenommen und einige andere Wertsachen. Das war damals nichts Ungewöhnliches: Die Beamten haben mich und viele andere Bürger "besteuert", wenn man so will, um ihr schlechtes Gehalt aufzubessern. Das ging in meinem Fall ohne physische Gewalt vonstatten, ich habe mich nicht gewehrt. Aber ich kenne Leute, die Opfer von Gewalt geworden sind. Fast jeder in Mexiko tut das.
Woher rührt das? Ist die mexikanische Gesellschaft gar per se besonders gewalttätig?
Mexikos Geschichte ist zwar geprägt von gewaltvollen Ereignissen, der Conquista etwa, dem Unabhängigkeitskampf, der Revolution. Aber es wäre ein Fehler, die gesamte mexikanische Gesellschaft als übermäßig gewaltbereit zu charakterisieren: Es gibt nichts an sich Gewalttätiges an der mexikanischen Kultur. Nicht mehr jedenfalls als in anderen Ländern. Die Gewalt in Mexiko ist nur besonders plakativ, sie ist oft außerordentlich grausam, richtet sich auch gegen Frauen und Kinder, und in manchen Regionen bestimmt sie den Alltag fast komplett. Und das liegt natürlich vor allem am organisierten Verbrechen, das in Mexiko von Drogenkartellen geprägt ist.
Der Aufstieg dieser Kartelle wäre nicht möglich gewesen ohne korrupte Polizei- und Justizbehörden. Mexikanische Beamte haben mitverdient am Drogenschmuggel, ihn sogar systematisch gefördert. Wie ist dieses extreme Ausmaß der Korruption zu erklären?
Das ist die Schlüsselfrage, und um sie zu beantworten, muss man ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Nach Mexikos Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Spanien im Jahr 1821 war der junge Staat sehr schwach. Er hatte kein Geld, wurde hauptsächlich von Militärs kontrolliert, die sich die ganze Zeit gegenseitig bekämpften. Damals ist auch das Justizsystem, das während der Kolonialzeit noch gut ausgestattet war, quasi ausgeblutet. Es wurde erst im späten 19. Jahrhundert unter dem Diktator Porfirio Díaz wieder aufgebaut. Aber in einer Weise, die dazu führte, dass Polizisten und Richter dem Regime dienten, nicht der Gerechtigkeit, dass Gesetze nicht für alle gleichermaßen galten. Arme Mexikaner mit indigenem Aussehen waren für die Polizei fast eine Ware, sie konnten wegen Kleinigkeiten verhaftet und zu jahrelanger Zwangsarbeit verurteilt werden. Weiße, wohlhabende und gut vernetzte Mexikaner dagegen kamen so gut wie nie ins Gefängnis. Das hat die Legitimität der Behörden untergraben, den Glauben an die Justiz. Damals begann die Schieflage, unter der wir bis heute leiden.
Und die sich offensichtlich auch durch die Mexikanische Revolution und das Ende der Díaz-Diktatur nicht besserte?
Mit der Revolution hat sich die Lage insofern noch verschlimmert, als dass die mit ihr einhergehenden, vielfältigen Konflikte zu einer Fragmentierung der Polizeikräfte führten. Die Bundesregierung verfügte über ihre eigenen Polizisten, dann gab es lokale Einheiten in den Bundesstaaten, den einzelnen Städten. In ihren Regionen dienten die Polizisten dem Machterhalt des Gouverneurs oder Bürgermeisters und genossen im Gegenzug ein hohes Maß an Autonomie. Ihr Polizeiabzeichen brachte ihnen im Grunde Straffreiheit. Sie konnten illegale Dinge tun, ohne dafür belangt zu werden. Auch dieses Durcheinander der Behörden und die mangelnde Transparenz ist bis heute nicht gelöst. Das ist zentral für Korruption und Willkür. Nach der Revolution jedenfalls war es normal für die Polizei, Bürger zu "besteuern", sie also zu berauben. Und in viel größerem Maßstab passierte das dann auch mit den Drogenhändlern, als deren lukratives Geschäft ab den 1920er Jahren wuchs.
Das System war da schon so korrumpiert, dass die staatliche Beteiligung am Drogengeschäft zwangsläufig war?
Der Begriff korrumpiert reicht kaum aus, um die Verstrickungen zu beschreiben, durch die Offizielle vom Verbrechen profitierten. Und auf seine perfide Art und Weise hat dieses System bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Die Drogenhändler verdienten viel Geld und mit ihnen die korrupten Polizisten, Richter und Politiker. Die Mordraten, die direkt nach der Revolution noch sehr hoch waren, gingen zurück. Das Land wurde friedlicher. Erst in den 1990er Jahren stieg die Gewalt wieder an.

Damals begannen rivalisierende Kartelle, um Territorien zu kämpfen.
Ja, bis dahin kontrollierte die Polizei die Drogenhändler, konnte sie im Großen und Ganzen zwingen, das zu tun, was sie wollte. In den 1990er Jahren aber änderte sich das Kräfteverhältnis. Die Kartelle wurden durch den boomenden Kokainhandel immer reicher, kauften nun zunehmend die Polizisten für ihre Zwecke. Und sie wurden auch gewalttätiger, bauten ihre eigenen militärischen Einheiten auf. Gnadenlos waren sie natürlich auch vorher schon, aber nun wurde Gewalt zum Kernbestandteil ihres Geschäfts. Wenn Drogenhändler einen Ort von einer anderen Gruppe übernahmen, kam es vor, dass sie alle Polizisten dieses Ortes erschossen – weil sie ahnten oder wussten, dass die Beamten für ihre Vorgänger gearbeitet hatten. Und auch untereinander bekämpften sich die Kartelle zunehmend brutal. Und das spiegelte sich in der Zahl der Menschen, die getötet wurden.
Um dem Kampf der Kartelle ein Ende zu setzen, schickte der damalige Präsident Felipe Calderón 2006 Tausende Soldaten gegen die Narcos. Das führte aber zu noch viel mehr Todesopfern, zu dem blutigen Ringen zwischen dem Staat und den Narcos, das heute als "Mexikanischer Drogenkrieg" bekannt ist.
Calderón stand sehr unter Druck, als er 2006 an die Macht kam. Viele Mexikaner meinten, sein knapper Wahlsieg sei gefälscht gewesen, und es gibt tatsächlich konkrete Hinweise dafür. Jedenfalls wollte er ein Zeichen der Stärke setzen. Also hat er sich eine Militärjacke angezogen und ist zur Armeeführung gegangen und hat ihnen gesagt: Ich setze voll auf euch, ihr bekommt von mir alles, was ihr braucht. Das war weniger eine ausgeklügelte Strategie gegen die Kartelle als politisches Kalkül: Entschlossenheit demonstrieren, das Militär an sich binden.
Fairerweise muss man sagen, dass der Krieg der Kartelle ja schon im Gange war …
Absolut. Und er wäre auch ohne Calderón weiter eskaliert. Aber die Armee ohne wirklichen Plan in diesen Konflikt hineinzuwerfen, hat sicherlich nicht geholfen. Die Soldaten konnten das Geschehen oft ja gar nicht durchschauen, verhafteten oder erschossen Leute, ohne deren genaue Rollen im System der Narcos zu kennen.
Einen anderen Ansatz gegen die Drogenkriminalität hat ab 2018 der linke Präsident Andrés Manuel López Obrador gewählt.
Und auch seine Regierungszeit war diesbezüglich ein großer Misserfolg!
Warum?
Er hat die Situation meiner Meinung nach falsch eingeschätzt. Im Grunde genommen war seine Sicht: Lasst uns keine Gewalt erzeugen, indem wir zu aggressiv mit dem Problem umgehen. Wenn wir uns stattdessen auf die soziale Situation konzentrieren, auf die Verbesserung der Bildung, der Einkommensverteilung, der Gesundheit, dann wird die Kriminalität automatisch abnehmen, die strukturellen Gründe für die Gewalt werden verschwinden. Aber so einfach ist es nicht, der soziale Ansatz allein ist nicht die Lösung.
Was ist die Lösung?
Die Lösung besteht erst mal darin, die Komplexität des Problems zu erkennen. Das klingt selbstverständlich, ist in Mexiko aber bisher nicht passiert. Man braucht fraglos den sozialen Ansatz. Man muss sich mit Ungleichheit, schlechter Bezahlung für Polizisten und daraus erwachsender Korruption auseinandersetzen. Aber man muss auch die Art und Weise überdenken, wie Strafverfolgung funktioniert. Wenn die Wahrscheinlichkeit, für einen Mord belangt zu werden, bei weniger als einem Prozent liegt, dann senkt das die Hemmschwelle. Steigt die Gefahr auf 50 Prozent, ändert das das Kalkül der Täter. Man überlegt sich zweimal, ob man jemanden erschießt. Die Gewalt wird runtergehen. Bei der Strafverfolgung wurde bisher aber viel zu einseitig auf die Exekutive gesetzt, auf mehr Training und Waffen für Soldaten und Polizisten. Vernachlässigt wurde dagegen das Justizsystem, in meinen Augen ein großer Fehler.
Was konkret muss geschehen?
Die Justiz muss besser ausgestattet werden. Täter müssen verurteilt werden. Und darüber hinaus muss das System einheitlicher und transparenter werden, sodass die Menschen die Leistung des Staates gegen das Verbrechen besser einschätzen können. Im Moment kursieren viele Statistiken unterschiedlicher Behörden, die kaum nachvollziehbar sind und mitunter nicht zusammenpassen. Das untergräbt die Legitimität des Systems und führt dazu, dass die Menschen den Behörden nicht vertrauen.
Wie zeigt sich dieses mangelnde Vertrauen?
Um nur ein besonders trauriges Beispiel zu nennen: Viele Familien, die vermuten, dass ihre Kinder getötet wurden, gehen nicht zur Polizei. Sie erwarten keine Gerechtigkeit vom Staat. Sie erwarten gar nichts. Alles, was sie wollen, ist, die Leiche zu sehen, um Gewissheit zu haben.

Ein anderes Beispiel für den verlorengegangenen Glauben an den Staat sind die sogenannten "autodefensas": bewaffnete Bürgerwehren, die versuchen, sich ohne den Staat gegen die Kartelle zu wehren.
Ja, solche Bürgerwehren gibt es in manchen Regionen, in denen die Kartelle operieren, in Michoacán zum Beispiel oder in Guerrero, meist in kleineren Orten. Den Menschen dort ist es egal, was die Regierung in Mexiko-Stadt oder in der Hauptstadt ihres Bundesstaates tut. Sie haben das Gefühl, sich selbst verteidigen zu müssen. Sie kaufen Waffen und Funkgeräte, leisten Widerstand. Aber die Armee mag das gar nicht. Die Regierung rät davon ab. Und wo sie können, entwaffnen sie diese Organisationen. Die Bürgerwehren haben also zwei Feinde: die Kriminellen und die Bundesregierung. Aber davon abgesehen haben die Autodefensas noch ein grundsätzliches Problem.
Nämlich?
Damit sie funktionieren, brauchen sie Leute, die Erfahrung in der Anwendung von Gewalt haben. Du kannst nicht einfach deinem Nachbarn sagen, er solle sich eine Waffe schnappen und anfangen zu schießen. Jemand muss das Know-how für solche Sachen haben. Und in der Regel sind das Leute, die mit Verbrechen zu tun haben. So verschwimmen mitunter die Grenzen zwischen den Bürgerwehren und den Kartellen. Deshalb sollten wir sehr kritisch auf die Bürgerwehren blicken.
Gibt es in dieser vertrackten Lage überhaupt etwas, das Ihnen Hoffnung macht.
Oh doch, so manches. Es ist ja nicht so, dass das ganze Land gleichermaßen vom Drogenkrieg betroffen ist. In vielen Regionen ist die Kriminalität kaum höher als in den USA. Mexiko-Stadt ist ein gutes Beispiel, wie sich Dinge zum Besseren wenden können. Die Politik hat dort gerade in den vergangenen Jahren einen guten Job gemacht: Es gab systematische Anstrengungen, die Gehälter von Polizeibeamten zu erhöhen, ihnen einen geregelten Karriereweg zu ermöglichen. Früher waren Polizisten nahezu gezwungen, nebenbei noch Geld zu machen, das war Teil des Systems. Das ist heute zum Glück anders. Solche Situationen, wie ich sie in den 1980er Jahren auf den Straßen von Mexiko-Stadt erlebt habe, sind dort heute viel seltener. Die Kriminalität in Mexiko-Stadt ist auch eindeutig zurückgegangen. Die Politiker dort machen manches richtig, sie arbeiten hart und sind nicht einfach nur populistisch. Das ist übrigens überhaupt etwas, das man positiv herausheben kann an Mexiko im Vergleich mit anderen lateinamerikanischen Staaten, die ähnliche Probleme haben und einseitig zur Politik der harten Hand tendieren.
Was meinen Sie?
Die Politik in Mexiko leidet nicht unter rechtem Populismus wie etwa in Brasilien, Peru oder Argentinien. Das Land ist nicht gespalten in eine radikale Linke und eine neoliberale, halbfaschistische Rechte. Der Großteil der Mexikaner ist bei ihren politischen Zielen vergleichsweise nah beieinander, etwa wenn es um funktionierende Sozialsysteme oder faire Wahlen geht. Das sind eigentlich gute Voraussetzungen für Stabilität und Kontinuität. Es braucht aber eben fähige Leute, um diese Voraussetzungen zu nutzen und strukturelle Dinge zu ändern.
Hilfreich dafür könnte auch die wachsende mexikanische Wirtschaft sein. Manche Stimmen sehen Mexiko schon als eine kommende wirtschaftliche Supermacht, die Deutschland spätestens 2050 ökonomisch überholen wird.
Das halte ich für übertrieben, aber ich bin auch kein Ökonom. Tatsächlich erlebt Mexiko ein starkes industrielles Wachstum. Viele Firmen wollen hier produzieren, weil die Kosten gering und die Qualifikationen der Mitarbeiter gut sind. Die Hochschulen expandieren, um mehr Ingenieure ausbilden zu können. Denn da gibt es Bedarf, übrigens auch, weil nicht wenige hochqualifizierte Mexikaner Angebote von Firmen aus den USA bekommen und in den Norden in die Vereinigten Staaten gehen.
Das passt zu einer weiteren Prognose, die man immer wieder hören kann: Dass die in den USA stetig wachsende Gruppe von Wählern mit mexikanischen Wurzeln dazu führen wird, dass Washingtons Politiker die Bedürfnisse Mexikos zukünftig stärker werden berücksichtigen müssen – eben, weil diese Wähler wollen, dass es ihrer Heimat möglichst gut geht.
Da bin ich skeptisch, aus zwei Gründen. Erstens hat die mexikanische Regierung dieses politische Kapital bisher nicht mobilisiert. Sie war nicht in der Lage, die Tatsache auszunutzen, dass viele Menschen mexikanischer Abstammung in den USA leben. Sie hat keinen Druck gemacht, etwa bei Fragen zur Migration, schlechte Lobbyarbeit geleistet, wenn man so will. Sie pflegt zu den USA eher eine Beziehung, die auf Schadensbegrenzung aus ist, und ich sehe derzeit nicht, wie sich das grundsätzlich ändern könnte. Das liegt zweitens auch daran, dass die spanischsprachige Bevölkerung in vielen Regionen der USA mehrheitlich republikanisch wählt. Es ist längst nicht immer so, dass die persönliche Migrationsgeschichte dazu führt, dass man es anderen Immigranten einfacher machen will und dementsprechend wählt. Das finde ich bedauerlich, aber das ist die Wahrheit. Es gibt allerdings eine demografische Entwicklung innerhalb Mexikos, in der ich Anlass zur Hoffnung sehe.
Nämlich?
Mexiko hatte bis in die 1970er Jahren sehr hohe Geburtenraten. Viele der damals geborenen Menschen haben in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten danach keinen Job gefunden, nicht wenige, vor allem junge Männer, sind auf die schiefe Bahn geraten. Diese Generation wird jetzt alt, die Bevölkerung wächst deutlich weniger stark, der Wirtschaft geht es besser. Die Probleme der Ungleichheit und der Armut sollten so leichter zu bewältigen sein. Sie haben anfangs einen etwas düsteren Satz aus einem meiner Bücher zitiert. Der stimmt leider, Mexiko steht nach Ansicht vieler Menschen für Gewalt und Straflosigkeit. Aber das heißt wie gesagt nicht, dass die mexikanische Gesellschaft in Gänze davon geprägt ist. Die plakative Gewalt der Drogenkartelle zieht alle Aufmerksamkeit auf sich, etwa in den Medien. Was dabei oft untergeht: Trotz der wirklich schwierigen Lage im Land laufen die allermeisten sozialen Interaktionen in Mexiko ohne jegliche Gewalt ab. Die allermeisten Menschen im Land versuchen weiterhin, ein friedliches, rechtschaffenes Leben zu führen. Das finde ich bemerkenswert, und das wäre auch mal eine Nachricht wert.

Haben Sie die Hoffnung, dass sich durch die Parlamentswahlen am 2. Juni generell etwas ändern wird?
Man muss diese Hoffnung einfach haben. Die Kandidatin der Regierungspartei, Claudia Sheinbaum, ist eine sehr kluge, fleißige, ergebnisorientierte Person. Keine von den üblichen Politikern, die man in Mexiko kennt, die nur gut aussehen und Netzwerke aufbauen wollen. Sie war bereits Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt und hat sich erfolgreich bemüht, die Dinge dort zu verbessern. Es gibt auch keine Belege für Korruption in ihrem Umfeld. Andererseits gehört sie einer Koalition unterschiedlicher Gruppen an – und da will jeder ein Stück vom Kuchen abhaben. Sie wird sich also mit Verbündeten auseinandersetzen müssen, die vielleicht nicht so leistungsorientiert sind wie sie, sondern Forderungen und Ansprüche stellen. Wie gut sie damit umgeht, wird über ihren Erfolg entscheiden. In Mexiko-Stadt jedenfalls ist die Kriminalität eindeutig zurückgegangen – die Frage ist, ob sie die gleichen Strategien auch auf Bundesebene anwenden kann.
Gleich zwei der Kandiaten für das Präsidentenamt sind Frauen. Wir werden also wohl bald die erste mexikanische Präsidentin im Amt sehen.
Es gibt in Mexiko bereits viele Frauen in der Politik, in den Parteien, im Kongress. Das begrüße ich sehr. Und es spiegelt größere gesellschaftliche Veränderungen wider. Bedeutende soziale Bewegungen in Mexiko gingen nämlich beispielsweise von jungen Frauen aus, die sich organisiert haben, um für das Recht auf Abtreibung zu kämpfen. Abtreibungen sind jetzt in den meisten Bundesstaaten legal. Vorher waren sie ein illegales Geschäft, bei dem die Polizei über die Ärzte mitkassiert hat. Das ist jetzt fast vorbei. Und das ist auch gut so.