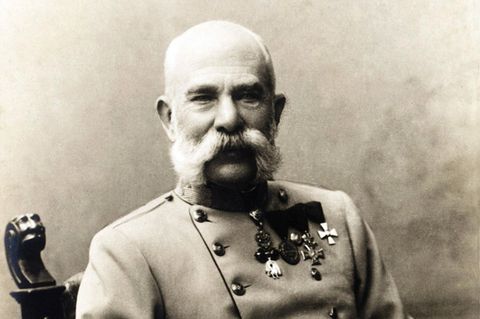Was der Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant im Juni 1859 in den Ortschaften nahe dem norditalienischen Dorf Solferino sieht, lässt ihn zeitlebens nicht mehr los. Mit fürchterlichen Verletzungen liegen Soldaten dicht gedrängt in Kirchen, Kasernen oder unter freiem Himmel. Sie sterben an Wundbrand, weil sie nicht rechtzeitig versorgt werden.
Ärzte führen ohne Narkose Amputationen durch. Soldaten betteln auf dem Operationstisch um den Tod. Es mangelt an Pflegepersonal, Verbandszeug, Wasser, Nahrung. Tausende Verwundete müssen versorgt werden, nachdem Frankreich und das mit ihm verbündete Sardinien-Piemont in einer Entscheidungsschlacht gegen Österreich um die Besitzungen der Habsburger in Norditalien gerungen haben.
Das Leid der Soldaten traf Henry Dunant zutiefst
Überwältigt vom Leid der Verwundeten, vergisst Henry Dunant die Geschäftsinteressen, die ihn eigentlich in die Gegend geführt haben. Der 31-Jährige kauft dringend benötigtes medizinisches Material, wechselt eigenhändig Verbände, spendet Trost. Und in ihm wächst eine Idee: Dunant will eine Hilfsgesellschaft für die Pflege von Kriegsverletzten gründen.
Das Schicksal verwundeter Soldaten wird bis dahin kaum öffentlich beachtet. Dabei gibt es in der Oberschicht jener Jahre durchaus Bestrebungen, den Schwächeren zu helfen. Mit weltlichen Gaben und christlichem Großmut wollen reiche Wohltäter die Armut der Massen mildern – allerdings ohne die Klassenunterschiede aufzuheben.
Auch im calvinistisch geprägten Genf findet die Idee, im Namen des Glaubens Gutes zu tun, Sympathisanten. Das Handels- und Bankenzentrum hat viele wohlhabende Bürger. Zwischen 1810 und 1875 entstehen dort rund 200 Hilfswerke. Auch der 1828 in Genf geborene Dunant engagiert sich früh für Benachteiligte. Für den gläubigen Christen ist es ein Akt der Nächstenliebe.
Gleichzeitig betätigt er sich jedoch auch als Kolonialunternehmer: Mit einer Aktiengesellschaft will er im französischen Algerien zu Wohlstand kommen. Vermutlich um persönlich beim Kaiser von Frankreich für seine Geschäftsidee zu werben, reist er Napoleon III. im Juni 1859 auf dessen Feldzug gen Italien nach – und wird so Augenzeuge des Leids der Soldaten.
Dunants Engagement wird Millionen Leben retten
1862 erscheint sein Buch "Eine Erinnerung an Solferino". Ungeschönt beschreibt er darin seine Beobachtungen aus den Behelfslazaretten und entwickelt die Vision eines humanitären Völkerrechts. Es sieht Regelungen für die Kriegsführung und den Schutz von Verletzten vor. Dabei argumentiert Dunant aber nicht etwa als Pazifist gegen den militärischen Kampf, denn der ist in weiten Teilen Europas allgegenwärtig. Er plädiert für die Pflege der Kriegsopfer.
Mit Gleichgesinnten um den Schweizer Juristen Gustave Moynier und dem General Guillaume-Henri Dufour gründet er 1863 das Internationale Komitee für Verwundetenhilfe: das spätere Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das weltweit Millionen Menschen in Kriegen, Krisen und Katastrophen das Leben retten wird.
Unermüdlich wirbt er bei Europas Mächtigen für einen Kongress zum Thema in der neutralen Schweiz. Der Bundesrat in Bern unterstützt Dunants völkerrechtliches Engagement und lädt offiziell zur diplomatischen Konferenz nach Genf ein. Das Treffen wird ein voller Erfolg.
Am 22. August 1864 verabschieden Vertreter von zwölf Staaten die sogenannte Genfer Konvention: Erstmals wird die Versorgung von Kriegsverwundeten verbindlich geregelt und Verletzten, Helfern und Spitälern volle Neutralität zugesichert. Zuvor war bereits eine einheitliche Kennzeichnung der Helfer gefunden worden: ein rotes Kreuz auf weißem Grund (eine einfache Farbumkehr der Schweizer Flagge).
1901 bekam Dunant den ersten Friedensnobelpreis
Dunants privates Unternehmen indes scheitert. Nach erfolglosen Investitionen in Algerien wird er 1868 wegen Betrugs verurteilt, sein geschäftlicher Ruf ist ruiniert. Jahrzehntelang lebt Dunant verarmt und zurückgezogen, engagiert sich aber bis zu seinem Tod am 30. Oktober 1910 in humanitären Fragen.
Heute sind die Genfer Konventionen, der ersten folgten noch drei weitere und drei Zusatzprotokolle, von 196 Ländern anerkannt. Der Mann, der maßgeblich dazu beigetragen hat, erfährt schließlich noch eine späte Ehrung: Gemeinsam mit dem französischen Pazifisten Frédéric Passy erhält der 73-Jährige im Dezember 1901 den ersten Friedensnobelpreis.