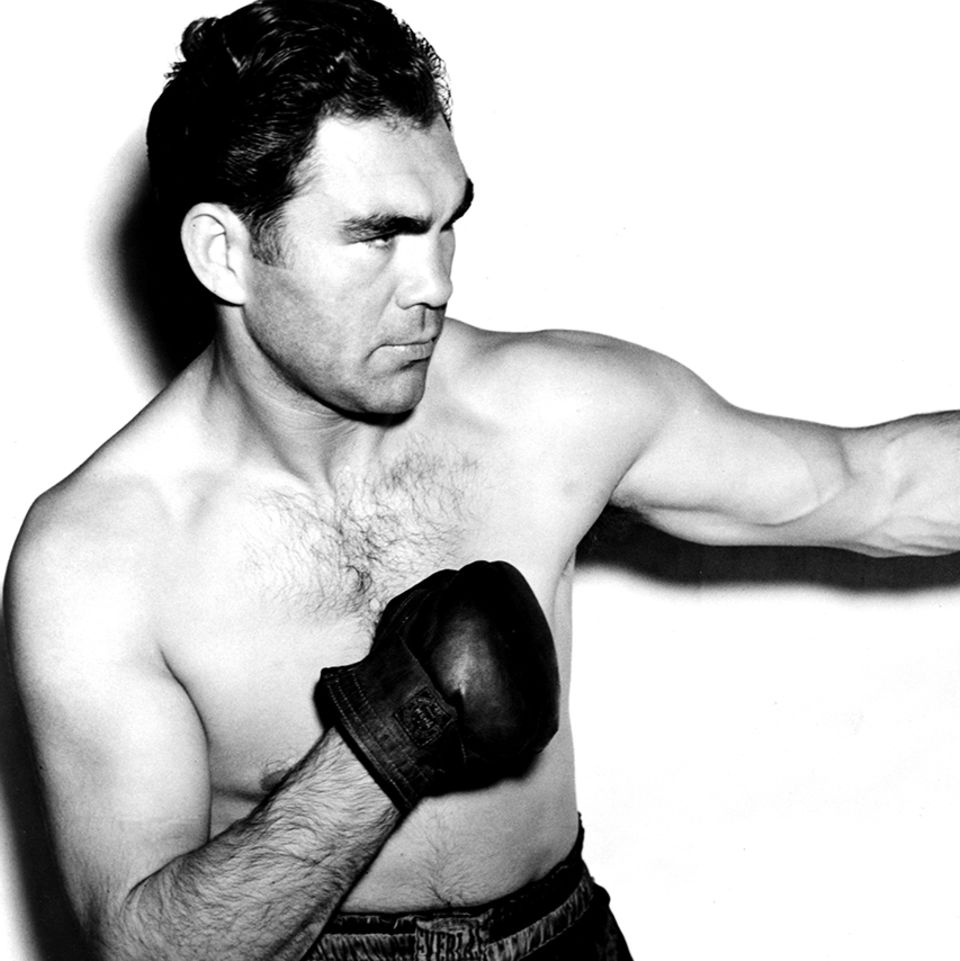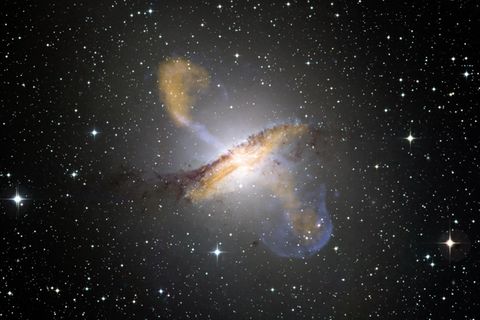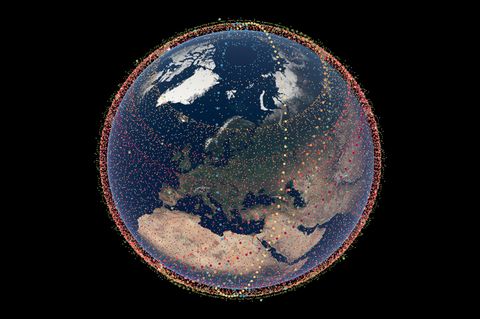Am Abend des 24. Oktobers 1924 trauen die Hörerinnen und Hörer des Senders "Frankfurt am Main auf Welle 467" ihren Ohren kaum. Zuerst meldet sich der Moderator wie gewohnt, dann aber wird er in einem fort gestört, von der Dame, die ansonsten für die Märchensendungen zuständig ist und sich unbedingt beim konservativen künstlerischen Sendeleiter, einem gewissen Herrn Doktor, Gehör verschaffen will, von Klopfen an der Tür, Telefonanrufen. Alles geht über den Äther, weil der Moderator die Schalter auf seinem Pult nicht mehr bedienen und somit die Mikrofone nicht ausschalten kann. Wie von Zauberhand ist alles eingefroren, ja macht sich selbstständig. Unwillkürlich wird Musik eingespielt. Der Moderator versucht sein Bestes, das Chaos zu beherrschen.
Gut 20 Minuten dauert das Stück "Zauberei auf dem Sender" des innovationsfreudigen Radiopioniers Hans Flesch, bei dem die Zuhörerschaft nicht nur prächtig unterhalten wird, sondern auch spielerisch erfährt, wie das neue Medium funktioniert, von der Programmgestaltung über die Technik bis zur Abrechnung für die Musik. Dann platzt auch noch ein Zauberer hinein, der dem Sender aus Rache die ganzen Streiche spielt, weil er dort nicht auftreten durfte, und, so steht zu vermuten, vielleicht sogar Züge des Autors selber trägt.
All das wird an diesem Abend live gespielt und direkt übertragen. "Zauberei auf dem Sender" ist Deutschlands erstes Hörspiel.
1924 wird ein neues Radio-Genre geboren
"Was Hans Flesch gemacht hat, war buchstäblich visionär. Er hat alle Elemente eingesetzt, die auch heute noch im Hörspiel vorkommen", erläutert Marcus Gammel, Abteilungsleiter für Hörspiel, Feature und Klangkunst bei Deutschlandfunk Kultur: "Ich glaube, die große Konstante im Hörspiel ist die Stimme, das Sprechen, das Singen. Aber auch Geräusch und Musik waren schon in diesem ersten Hörspiel angelegt."
Als Tonspur ist die Sendung nicht erhalten, aber immerhin gibt es das Manuskript. "Die Aufzeichnung war zwar technisch rudimentär möglich, aber noch nicht in dem Maße, wie es für eine Produktion nötig wäre", sagt Gammel. "Außerdem verstand sich Rundfunk grundsätzlich als Live-Medium", eine Art akustische Bühne, deren Programm sich rasant fortentwickelt. Ebenso wie die Hörerschaft.
Das neue Medium ist einigermaßen erschwinglich. Die monatliche Rundfunkgebühr beträgt 1924 zwei Mark, was etwa dem halben Tageslohn eines ungelernten Arbeiters entspricht. Ende 1924 haben sich schon fast 550.000 Haushalte angemeldet, ein Jahr später bereits rund eine Million – nicht mitgezählt eine erhebliche Zahl von Schwarzhörern, denn tatsächlich kann man sich die Empfänger relativ einfach selbst bauen.
Die Vielfalt im Radio kommt erst in der Nachkriegszeit
Das Programm an sich kommt anfangs noch recht schwerfällig daher, die Macher stehen in der Bildungstradition des 19. Jahrhunderts. Aber das ändert sich mit dem Zeitgeschmack, dem auch die Hörspiele folgen. Doch erst in der Nachkriegszeit entsteht in Westdeutschland mit den verschiedenen Landesfunkanstalten eine Hörspiellandschaft, die in ihrem Facettenreichtum ihresgleichen sucht.
Während Technikentwicklungen bis hin etwa zum Sampling der literarischen Kunstform Hörspiel neue Möglichkeiten eröffnen, beginnt in den 1970er-Jahren eine weitere Revolution des Genres jenseits der sogenannten Hochkultur und auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Kommerzielle Hörspielstudios wie "Europa", "Kiosk" und "Maritim" richten sich mit Produktionen wie "Die drei ???", "TKKG" oder "Bibi Blocksberg" bewusst an eine junge Hörerschaft. Vermutlich ohne zu ahnen, dass sie die ab 1970 geborenen Generationen sehr, sehr lange begleiten würden, teils bis ins Erwachsenenalter.
Die "Kasettenkinder" von damals sind die Fans von heute
Die "Europa"-Chefin Heikedine Körting erinnert sich, dass der Zeitpunkt für den Start von "Die drei ???" im Herbst 1979 nicht hätte besser sein können. Im Gegensatz zu Kindern in den USA hätten Jungen und Mädchen hierzulande damals noch keinen Fernseher im Kinderzimmer gehabt und auch nur wenig Programme gucken dürfen. "Europa" hat die Kassetten dann zum Preis von fünf D-Mark auf den Markt gebracht und auch vom Boom des "Walkman" profitiert, von den ersten mobilen Abspielgeräten für Kassetten, die dann später durch CD-, MP3- und schließlich Smartphones abgelöst wurden.
Körting resümiert den Erfolg des Audioformats so: "Die Kassetten wurden rauf und runter gehört, nicht nur einmal oder zweimal, nein, immer wieder und wieder. Und so haben sich die Geschichten fest eingeprägt. Die Generation dieser 'Kassettenkinder' liebt Hörspiele wie wohl keine andere vor ihr." Und sie ist den Sprechern und Sprecherinnen treu, teils bis heute. Beides wohl Gründe dafür, dass Hörspiele in Deutschland zum 100. Jubiläum des Genres so beliebt sind wie nirgendwo sonst auf der Welt.
Hörtipp: In der Audiothek der ARD ist das erste deutsche Hörspiel "Zauberei auf dem Sender" in einer Fassung von 1962 abrufbar.