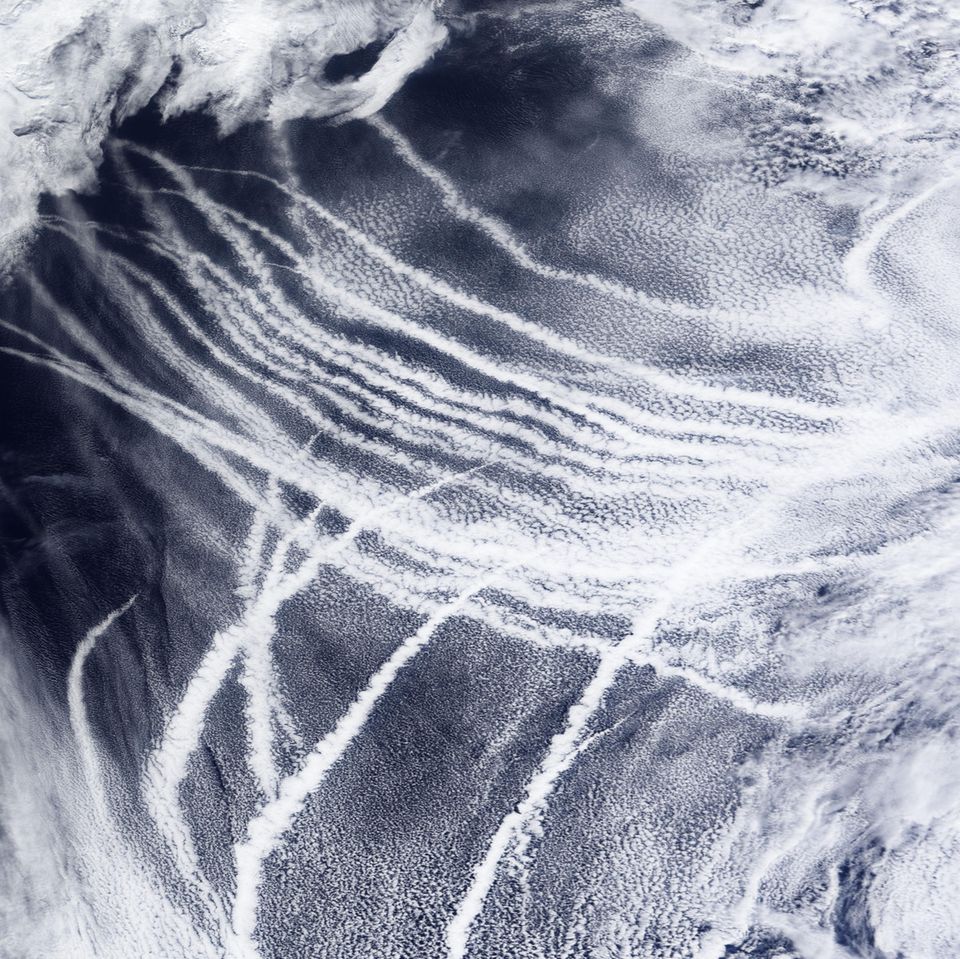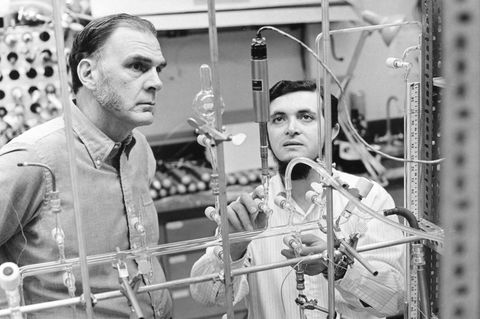Die Erde mit künstlichen Sonnensegeln im All beschatten? Die Ozeane mit Eisen düngen, um der Atmosphäre CO2 zu entziehen? Mit fortschreitendem Klimawandel suchen Forschende fieberhaft nach schnellen technischen Lösungen, um die Erderwärmung abzubremsen.
Mit einem ungewöhnlichen Vorschlag warteten Forschende aus Skandinavien Anfang dieses Jahres auf: Sie schlugen vor, einen besonders empfindlichen Teil des Westantarktischen Eisschildes durch eine Art unterseeischen Vorhang zu schützen. Die rund 80 Kilometer lange und 100 Meter hohe Barriere könnte, so die Idee, warmes Tiefenwasser daran hindern, die in den Ozean ragenden Eiskappen von unten abzuschmelzen. Das Motiv ist klar: Berechnungen zufolge würde allein das Auftauen des Westantarktischen Eisschildes zu einem Meeresspiegelanstieg um etwa fünf Meter führen. Pro Stunde verliert die Antarktis rund 17 Millionen Tonnen Eis. Das entspricht einem Eiswürfel mit einer Kantenlänge von 260 Metern.
Doch von einer Umsetzung ist die Staatengemeinschaft weit entfernt. Denn noch ist völlig unklar, ob das Ganze überhaupt realisierbar ist. Neben technischen Fragen müsste das gigantische Bauwerk ja auch finanziert und instand gehalten werden. Nun warnen zwei Völkerrechtsexperten: Das Projekt, das Hunderte Millionen Menschen in den Küstenregionen der Erde schützen soll, könnte selbst zum Gegenstand internationaler Auseinandersetzungen werden.
Ungeklärte völkerrechtliche Fragen und Konsequenzen
Den Forschern zufolge muss zugleich mit Fragen der technischen Realisierbarkeit geklärt werden, wer oder welches Gremium über die Durchführung eines solchen Menschheitsprojekts entscheidet. Und welche Auswirkungen es auf territoriale Ansprüche in der Antarktis hätte. Drittens wäre vorab die Frage zu klären, wie eine solche kritische Infrastruktur in einer fast menschenleeren Gegend geschützt werden könnte.
In den drastischen Szenarios der im Fachmagazin "International Affairs" veröffentlichten Studie wird die gigantische Struktur zum Ziel eines Sabotageangriffs oder einer terroristischen Attacke – um tief liegende Küstenanrainerstaaten zu schädigen oder zu erpressen. Das Bauwerk müsste entsprechend bewacht und geschützt werden – und das "auf einem Kontinent, der derzeit entmilitarisiert ist und als einziger auf der Welt noch nie einen Krieg erlebt hat", wie es in dem Papier heißt.
Der Antarktisvertrag – ein bahnbrechendes Vertragswerk
Dreh- und Angelpunkt der Überlegungen der Studienautoren ist der Antarktisvertrag. Das Abkommen regelt, wie der Kontinent – ohne eigene Regierung und ohne Parlament – von allen Interessierten fair genutzt werden kann. Das Vertragswerk ist zwar nicht sonderlich bekannt, gilt aber als Vorzeigeprojekt internationaler Beziehungen: Am 1. Dezember 1959, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, unterschrieben Argentinien, Australien, Chile, Frankreich, Großbritannien, Neuseeland und Norwegen: allesamt Länder, die Gebietsansprüche in der Antarktis gestellt hatten. Hinzu kamen Südafrika, die USA und die frühere Sowjetunion. Mittlerweile gibt es mehr als 50 Unterzeichnerstaaten.
Der Vertrag untersagt den Mitgliedsstaaten Gebietsansprüche und friert die früher geäußerten ein. Er verbietet außerdem militärische Übungen, Atomtests und den Abbau von Bodenschätzen, erlaubt aber die Nutzung zu friedlichen Zwecken, darunter Forschung und Tourismus.
Die Studie werfe ein Licht auf die "politischen und rechtlichen 'Schatten', die sich hinter der aufregenden Oberfläche von Wissenschaft und Technologie verbergen", sagt der Völkerrechtsexperte Akiho Shibata von der japanischen Universität Kobe in einer Pressemitteilung. Die Weltgemeinschaft müsse Entscheidungen über die Entwicklung solcher Technologien auf der Grundlage eines gründlichen Verständnisses dieser negativen Aspekte treffen.