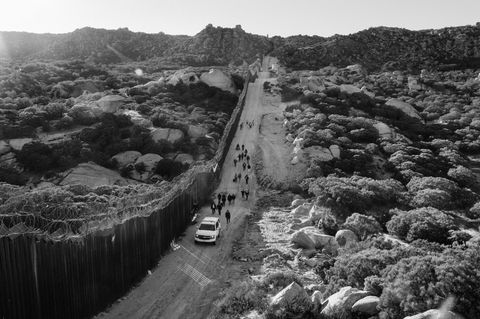Bilder von überfüllten Flüchtlingsbooten, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind, beherrschen immer wieder die Nachrichten. Auch die Hamburger Archäologin Geesche Wilts beschäftigt sich mit dem gefährlichen Weg der Migrantinnen und Migranten, allerdings aus einem anderen Blickwinkel: Sie untersucht die Boote, mit denen die Menschen Lampedusa erreicht haben. Ihre Arbeit zeigt: Archäologische Methoden helfen, die Geschichte der Geflüchteten zu bewahren.
GEO: Frau Wilts, seit bald zwei Jahren führen Sie archäologische Untersuchungen auf Lampedusa durch. Warum ist die italienische Insel, das Sinnbild der Flüchtlingskatastrophe, ein Fall für die Archäologie?
Geesche Wilts: Archäologen graben nicht ausschließlich im Boden nach Jahrtausende alten Dingen. Wir erforschen auch Objekte der Gegenwart, von denen wir wissen, dass sie historisch einmal relevant sein werden. Auf Lampedusa untersuche ich Flüchtlingsboote, um die Realität an Bord zu rekonstruieren. Natürlich kennen wir aus den Nachrichten Bilder von angekommenen Geflüchteten, aber über die Überfahrten selbst wissen wir wenig.
Warum sprechen Sie nicht einfach direkt mit den Menschen, die auf Lampedusa ankommen?
Davon abgesehen, dass die meisten direkt nach ihrer Ankunft extrem erschöpft sind und es Sprachbarrieren gibt, können Objekte Geschichten erzählen, die Zeuginnen und Zeugen in dem Moment überhaupt nicht wichtig erscheinen. Oft gibt es Details, die sie aus Gründen des psychischen Schutzes verdrängt haben. Manche erinnern sich nicht einmal, ob ihnen in der prallen Sonne heiß war. Insofern erweitern Objekte das Bild mündlicher Überlieferungen. Und da die Flüchtlingsboote nach einiger Zeit von den Wellen zermalmt oder von den Behörden abtransportiert und zerstört werden, müssen sie jetzt dokumentiert werden, genauso wie alle Hinterlassenschaften in ihnen.
Aus welchen Gründen könnte es einmal historisch relevant sein, was die geflüchteten Menschen auf den Booten zurückgelassen haben?
In 50 oder 100 Jahren wird es in Europa Nachfahren dieser Menschen geben, die vielleicht wissen möchten: Wie sind meine Großeltern oder Urgroßeltern über das Mittelmeer geflüchtet? Was waren das für Boote, auf denen sie nach Europa gekommen sind? Wie lief so eine Überfahrt konkret ab? Es geht darum, diesen Personen die Möglichkeit zu geben, ihre Familiengeschichte aufzuarbeiten. Außerdem bin ich überzeugt, dass meine Arbeit auch für unsere Gesellschaft heute wichtig ist. Schließlich zeigt sie neue Aspekte der Flüchtlingskatastrophe auf.

Aber es gibt doch kaum ein Thema, über das in den letzten zehn Jahren mehr berichtet wurde als über Migration.
Das stimmt zwar, aber wenn in den Nachrichten von Geflüchteten die Rede ist, geht es meistens um abstrakte Zahlen oder Bootsunglücke. Objekte dagegen wie Boote oder Kleidung sind sehr viel anschaulicher. Sie machen das, was im Mittelmeer passiert, greifbar.
Welche Geschichten erzählen die Boote?
Zum Beispiel, dass sich ihre Typologie in den letzten Jahren verändert hat. Ich habe bislang gut 60 Boote erfasst. Bis Juli 2023 sind Geflüchtete in der Regel auf Holz- oder Schlauchbooten auf die Insel gekommen. Im Spätsommer habe ich an der Küste Lampedusas dagegen vor allem Metallboote vorgefunden, genauer: Sie bestanden aus Schrott. Und bei meiner Exkursion 2024 habe ich in erster Linie Holzboote dokumentiert. So etwas wie das typische Flüchtlingsboot gibt es also gar nicht.
Was meinen Sie mit "Schrott"?
Die Boote wurden aus dünnen Metallteilen zusammengeschweißt – und zwar von Personen, die definitiv keine professionellen Schweißer sind. Das sieht man an den sehr unregelmäßigen, teilweise schiefen Nähten. Die einzelnen Bestandteile der Boote konnte ich bislang nicht genau identifizieren, weil sie komplett verrostet sind. Ich hoffe, mittels einer Röntgenfluoreszenzanalyse die Metallzusammensetzung herauszubekommen und damit auch den Ursprungsort der Platten. Jedenfalls habe ich beim Vermessen der Boote auffällige Gemeinsamkeiten entdeckt.
Und zwar?