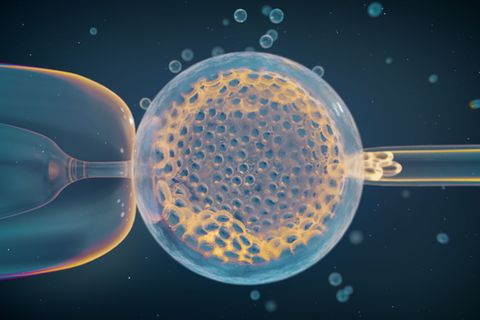GEO: Herr Professor Brisch, als führender Bindungsexperte Deutschlands haben Sie ein Programm entwickelt, mit dem Eltern bereits während der Schwangerschaft lernen, feinfühlig, prompt und angemessen auf die Signale ihres Kindes zu reagieren. Die emotionale Fürsorge, so sagen Sie, ist die entscheidende Zutat für die psychische und physische Entwicklung eines Kindes. Was brauchen Neugeborene neben vielen emotionalen Interaktionen noch, damit sie sich gut entwickeln?
Prof. Karl Heinz Brisch: Schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt wollen Babys manches selber entscheiden, Wissenschaftler sprechen von "Selbstwirksamkeit". Entweder sie saugen an der Brust – oder sie tun es nicht. Entweder sie schlucken – oder sie schlucken nicht. Entweder sie lächeln einen an – oder sie drehen den Kopf zur Seite. Bereits in diesen frühen Handlungen agieren Babys also selbstwirksam. Und daher ist es überaus wichtig, dass sie die Erfahrung machen: Mit meinen Handlungen, mit meinem Verhalten bewirke ich etwas.
Weil sie sich dann im Laufe der Zeit immer mehr zutrauen?
Genau. Ein Baby kann ja nicht die nächsten 50 Jahre bei der Mutter bleiben und von ihr versorgt werden. Vielmehr muss es frühzeitig Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit gewinnen, muss erleben, dass es etwas erreichen kann, wenn es sich anstrengt und bemüht – und sei es nur in kleinen Dingen.
Daher sollten Eltern vom ersten Tag an Situationen schaffen, in denen sich Kinder selbstwirksam erleben können. Dabei darf die Anforderung nicht zu hoch liegen, sonst werden die Kleinen rasch frustriert sein und die Freude an der Aufgabe verlieren; aber die Aufgabe darf auch nicht zu einfach sein, sonst werden sie sich bald gelangweilt zurückziehen.
Worauf kommt es an?
Väter und Mütter sollten Babys in ihrem Drang nach Selbstwirksamkeit nicht bremsen, sondern vielmehr unterstützen. Versucht ein Kleinkind beispielsweise beim Füttern nach dem Löffel zu greifen, können sie ihm dabei helfen, den Löffel fest zu umschließen und zum Mund zu führen. Beginnt es, aus Bauklötzen einen Turm zu bauen, können sie mithelfen, dass die ersten drei Klötze stabil aufeinander stehen bleiben. Derartige Erfolgserlebnisse bestärken die Selbstwirksamkeit außerordentlich. Irgendwann sagt sich das Kind: Nun schaffe ich auch vier oder fünf Klötze.
Und wenn es die Rutsche hochklettern möchte, braucht es womöglich nicht mehr die elterliche Hand zur Unterstützung, sondern vielleicht nur noch den kleinen Finger oder einen ermutigenden Blick und ein "Du schaffst das!". Väter und Mütter sollten immer darauf achten, genau hinzusehen, wie viel Hilfestellung gerade nötig ist, damit ein Kind eine Herausforderung bewältigen kann.
Und es nicht bevormunden.
Genau. Manche Mütter haben etwa beim Füttern den Impuls, den Löffel selbst zum Mund des Babys zu führen. Schließlich sind sie so schneller fertig. Doch irgendwann will ein Kind eigenständig Nahrung zu sich nehmen, es wird trotzig, ärgert sich, macht den Mund nicht mehr auf, sperrt sich. Oder es fängt an, um den Löffel zu kämpfen. Eine adäquate Reaktion ist dann: "Das finde ich ja toll, dass du jetzt den Löffel selber nimmst! Sieh mal an, wie gut du das schon schaffst! Ich freue mich so!" Denn wenn die Eltern die selbstbestimmten Handlungen ihrer Kleinen unterstützen und sich obendrein daran erfreuen, führt dies zu einem weiteren wichtigen Entwicklungsschritt.
Zu welchem?
Aus der Selbstwirksamkeit erwächst ein starkes Selbstwertgefühl. Die Kinder erfahren nicht nur: Ich kann, ich bewirke etwas. Sondern sie spüren auch: Meine Fähigkeiten werden geschätzt, ich erhalte Anerkennung, ich kann mich behaupten. Dazu braucht es den Glanz in den Augen der Eltern, die sich darüber freuen, wenn das Kind nach einem Turm aus vier Bauklötzen nun einen mit fünf schafft.

Oder wenn es sich das erste Mal an den Möbeln hochzieht und seine ersten Schritte wagt. Eltern sind in solchen Momenten zu Recht unendlich glücklich und stolz: "Toll, das ist unser Kind!", freuen sie sich. Dann strahlen sie – und ebenso das Baby, weil es diese wertschätzenden Gefühle der Eltern erlebt und regelrecht in sich aufsaugt.
Überaus wichtig ist zudem, dass Väter und Mütter das kreative Potenzial der Kleinen wertschätzen.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Kleine Kinder haben eine unglaubliche Freude an Variabilität und Flexibilität – also daran, mit Gelerntem in Hunderten Varianten spielerisch umzugehen. Beherrschen sie beispielsweise verschiedene Puzzles, fangen sie womöglich an, die Puzzles zu mischen, durch den Raum zu werfen, zu verstecken, wiederzufinden, neu zusammenzufügen. Eltern aber neigen nicht selten dazu, Kinder in diesem fantasievollen Prozess zu stoppen, weil es sich in ihren Augen nicht gehört, ein Puzzle durch den Raum zu werfen.
Sie sollten also mehr Freiheit lassen?
Absolut. Kaum etwas ist so wichtig für die geistige Reifung eines Kindes wie die Entfaltung seiner Schöpferkraft. Es wäre also toll, wenn sich die Mütter und Väter an solchen Vorgängen stärker freuen könnten. Wenn sie Rückmeldung geben und stolz auf die Experimente ihrer Kinder sind – etwa indem sie sagen: "Ich finde genial, was du da machst. Nie wäre ich darauf gekommen, dass man die Puzzleteile auch zerschneiden, bemalen oder in den Joghurt stecken kann, um zu schauen, wie das dann schmeckt!"
Muss ein Kind aber nicht auch lernen, dass es eben nicht alles darf?
Natürlich braucht der Nachwuchs bestimmte Grenzen, denn er weiß ja noch nicht, wann er in Gefahr ist – in seiner ungestümen Neugier mag er nach dem Putzmittel greifen und es trinken wollen, beim Spielen zu dicht an eine steile Treppe geraten oder noch nicht einschätzen können, wie viel Zeit er braucht, um eine breite Straße zu überqueren. Daher gehört zu einer feinfühligen Erziehung natürlich auch, die Tochter, den Sohn alters adäquat zu schützen, entsprechende Grenzen aufzuzeigen.
Was allerdings dazu führt, dass ein Kind wütend wird, weil es etwas nicht darf, was es gern möchte.
Es steht einem Kind zu, neugierig zu sein, die Welt erforschen zu wollen. Und ebenso hat es ein Recht darauf, wütend und frustriert zu sein, wenn es zum Beispiel das neue Smartphone der Eltern nicht untersuchen darf. Am liebsten würde es dazu eine ganze Versuchsreihe starten: Schwimmt das Telefon in der Badewanne? Taucht es von allein wieder auf? Hört man es auch unter Wasser?
Nun kommt es darauf an, ihm seine Wut zuzugestehen und es gleichzeitig liebevoll zu trösten, etwa indem man sagt: "Ich weiß, es wäre jetzt spannend, das Smartphone zu untersuchen, aber Mama möchte das nicht. Ich habe eine Idee, was du stattdessen erforschen könntest." Kinder verinnerlichen meist recht schnell, wo eine Grenze ist – und dass es eine Auseinandersetzung gibt, wenn diese Grenze überschritten wird.