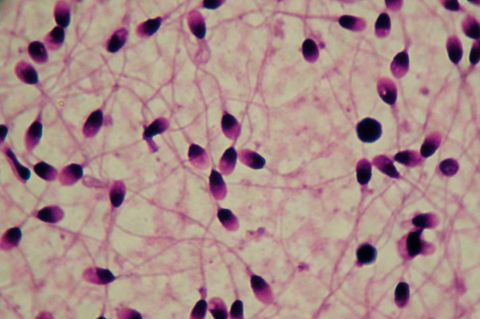Im Ramadan, also im neunten Monat des islamischen Kalenders, fasten jedes Jahr mehr als einer Milliarde Muslime und Musliminnen. Darunter natürlich auch Jugendliche. Ökonomen aus Konstanz, Köln und Bern haben jetzt herausgefunden, dass diese nach der Fastenzeit besser in der Schule abschneiden. Liegen die verbesserten Leistungen der Schüler etwa am Fasten selbst, dem ohnehin viele positive Auswirkungen auf Geist und Körper zugeschrieben werden? Die Forschenden haben eine andere Erklärung.
Fasten während Ramadan: Soziale Aktivitäten wirken sich positiv auf Schulleistung aus
Neben dem täglichen Verzicht auf Speisen und Getränke zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang nehmen viele Gläubige während des Ramadans verstärkt an sozialen Aktivitäten teil. Hierzu zählt beispielsweise das tägliche Fastenbrechen im Kreis von Freunden und Familie oder nach dem Gottesdienst mit der Gemeinde.
In ihrer aktuellen Studie kommen die Forschenden zu dem Schluss: Insbesondere die sozialen Aspekte des Ramadans scheinen sich bei jugendlichen Gläubigen positiv auf die Schulleistung auszuwirken. Die Forschungsergebnisse wurden im Journal of Economic Behavior and Organization veröffentlicht.
Leistungssteigerung durch gesteigertes Sozialkapital
In der Studie untersuchten die Forschenden die Frage, ob das Ramadanfasten einen über die Fastenzeit hinaus andauernden Effekt auf die Bildungsleistung von Achtklässlern hat und ob dieser in einem Zusammenhang mit der Fastenintensität steht. Ihr Ergebnis: Obwohl das körperlich anstrengende Fasten bekanntermaßen negative Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit während der Fastenzeit haben kann, schnitten Schülerinnen und Schüler in muslimischen Ländern bei der internationalen Schulleistungsuntersuchung TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) nach intensivem Ramadanfasten besser ab als nach einem weniger intensiven Ramadan.
Da intensiveres Fasten auch mit einer erhöhten Teilnahme an religiösen Aktivitäten wie Gottesdiensten einhergeht, vermuten die Autoren, dass die gesteigerten Schulleistungen insbesondere auf die sozialen Aspekte des Fastens zurückzuführen sind. "Unsere Forschungsergebnisse legen nahe, dass das Ausüben der religiösen Praktik die Bildung einer gemeinsamen Identität unter den Schülerinnen und Schülern fördert und das für den Bildungserfolg nützliche soziale Kapital erhöht. Dazu zählen beispielsweise Kontakt zu anderen Jugendlichen mit höherem sozioökonomischem Status, Unterstützung und Hilfeleistung oder Anerkennung und Wissen“, präzisiert Guido Schwerdt, Professor am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an der Universität Konstanz.
Bessere Schulleistung nach Fastenzeit nur bei Muslimen
Für ihre Studie machten sich die Forschenden die Tatsache zunutze, dass sich das Datum des Ramadans gemessen am Sonnenkalender jedes Jahr einige Tage nach vorne verschiebt. Da die Tageslänge von der Jahreszeit abhängt, verändert sich durch die jährliche Verschiebung des Ramadans auch die tägliche Fastendauer von Jahr zu Jahr. "Daraus ergeben sich über die Jahre betrachtet natürliche Schwankungen in der Fastenintensität der Gläubigen einer bestimmten Region, die wir mit Daten zur Schulleistung, die nach dem jeweiligen Ramadan erhoben wurden, in Verbindung gebracht haben", erklärt Schwerdt.
Die Auswertung der mehrjährigen TIMSS-Daten ergab dabei im Detail, dass eine erhöhte Fastenintensität in Ländern mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung mit besseren Schulleistungen einhergeht. In Ländern mit mehrheitlich nicht-muslimischer Bevölkerung gab es diesen Effekt nicht. "Anhand mehrjähriger PISA-Daten aus acht westeuropäischen Ländern konnten wir zusätzlich zeigen, dass Jugendliche, deren Eltern aus Ländern mit muslimischer Mehrheit stammen, in Jahren mit längerer täglicher Fastendauer relativ zu anderen Jugendlichen besser im PISA-Test abschnitten als in Jahren mit niedriger Fastenintensität", ergänzt Schwerdt.
An Schulen mit hohem Anteil an muslimischen Schülerinnen und Schülern ist dieser Effekt größer als an Schulen mit geringerem Anteil – ein weiterer Hinweis darauf, dass hier die sozialen Aspekte religiöser Aktivität und die Bildung einer gemeinsamen Identität eine Rolle spielen.