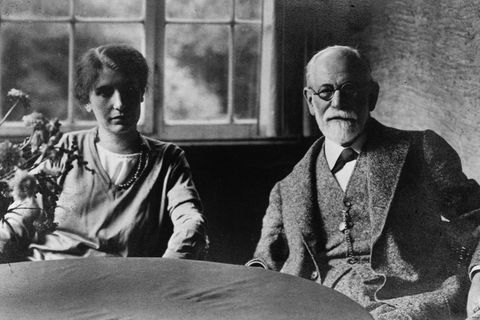GEO: Herr Professor Fink-Lamotte, wovor ekeln Sie sich am meisten?
Prof. Jakob Fink-Lamotte: Beim Windelnwechseln ekele ich mich die ganze Zeit. Schimmliges Essen finde ich auch noch sehr eklig oder tote Tiere.
Sie beschäftigen sich seit Jahren wissenschaftlich mit dem Ekel. Stumpft man dabei irgendwann ab?
Auf jeden Fall. Deswegen ist in der Verhaltenstherapie die Konfrontationstherapie auch das Mittel der Wahl. Je häufiger man sich bei einer Spinnenangst beispielsweise mit der Spinne beschäftigt und feststellt, dass sie einem nur über die Hand läuft und harmlos ist, desto weniger Angst erlebt man. Das gleiche funktioniert auch mit dem Ekel. Nur verläuft die Gewöhnung an Ekel deutlich langsamer und auch das Verlernen ist deutlich schwieriger als bei der Angst.
Trotzdem ekeln Sie sich noch.
Vielleicht ekele ich mich sogar mehr als andere. In dem Sinn, dass ich besonders darauf achte und denke: Ach, spannend, da ist es wieder, dieses Gefühl.