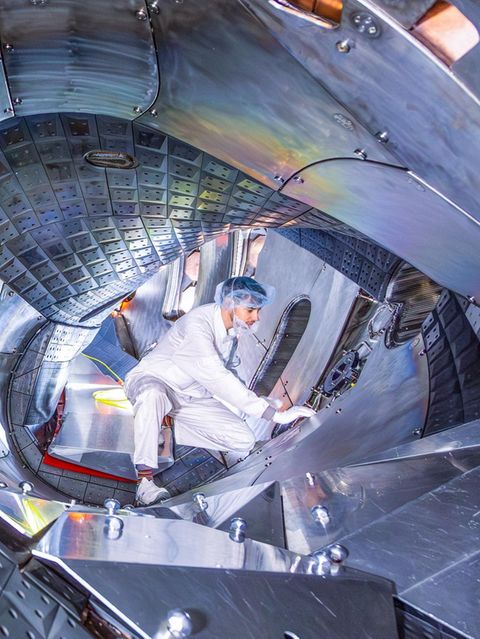Ein Spaziergang im Wald gilt als Mittel gegen Stress, ein Aufenthalt im Grünen als Balsam fürs Nervensystem. Doch für eine wachsende Zahl von Menschen ist Natur kein Ort der Erholung mehr, sondern eine Quelle von Unbehagen. Raschelnde Büsche wirken bedrohlich, Insekten ekeln, ungeordnete Landschaften verunsichern. Die Forschung kennt für dieses Phänomen einen Namen: Biophobie – die Abneigung gegenüber der Natur.
Lange Zeit dominierte in den Umwelt- und Verhaltenswissenschaften eine gegenteilige Annahme: dass Menschen sich der Natur grundsätzlich zugewandt fühlen. Geprägt wurde diese Vorstellung durch das Konzept der Biophilie, das eine angeborene emotionale Verbundenheit mit Pflanzen, Tieren und natürlichen Umgebungen beschreibt. Biophilie erklärt, warum Grün beruhigt, warum Kinder Tiere faszinierend finden und warum selbst kurze Naturkontakte messbare Effekte auf Gesundheit und Wohlbefinden haben können.
Doch dieses Bild ist unvollständig. Denn Nähe zur Natur ist keineswegs universell positiv besetzt. Eine neue Übersichtsarbeit der schwedischen Universität Lund rückt nun systematisch die Schattenseite der Mensch-Natur-Beziehung ins Blickfeld.
Die Angst vor dem Unkontrollierbaren
Für ihre Analyse werteten Forschende um den Umweltpsychologen Johan Kjellberg Jensen knapp 200 Studien aus unterschiedlichen Disziplinen aus, von Psychologie und Umweltwissenschaften bis zu Soziologie und Gesundheitsforschung. Das Ergebnis: Negative Emotionen gegenüber der Natur nehmen in vielen Weltregionen zu, über Altersgruppen und Kulturen hinweg.
Diese Gefühle entstehen nicht zufällig. Die Auswertung zeigt ein Zusammenspiel äußerer und innerer Faktoren. Zu den äußeren zählen vor allem urbane Lebenswelten, in denen Natur kaum noch alltäglich erlebt wird. Wer in dicht bebauten Städten aufwächst, begegnet Wildnis meist nur gefiltert, als Parkanlage, Fernsehbild oder Schlagzeile. Medienberichte über gefährliche Tiere, Krankheiten oder Naturkatastrophen können solche Distanz zusätzlich verstärken.
Hinzu kommen individuelle Voraussetzungen: Menschen mit erhöhter Ängstlichkeit, bestimmten gesundheitlichen Belastungen oder negativen Vorerfahrungen reagieren häufiger mit Furcht, Ekel oder Überforderung auf natürliche Reize. Natur wird dann nicht als bereichernd, sondern als unberechenbar erlebt.
Eine Abwärtsspirale der Distanz
Besonders problematisch ist, dass sich Biophobie selbst verstärken kann. Wer Natur meidet, sammelt weniger positive Erfahrungen und bleibt dadurch anfälliger für Vorurteile und diffuse Ängste. Fehlendes Wissen über Pflanzen, Tiere und ökologische Zusammenhänge verstärkt das Gefühl von Kontrollverlust. Die Forschenden sprechen von einer negativen Rückkopplungsschleife aus Distanz, Unsicherheit und weiterer Vermeidung.
Diese Dynamik beginnt oft früh. Laut Jensen können elterliche Einstellungen eine zentrale Rolle spielen: Wenn Erwachsene Natur primär als Gefahrenraum darstellen, übernehmen Kinder diese Sichtweise. In zunehmend urbanisierten Gesellschaften gewinnt dieser Effekt an Bedeutung. Immer mehr Kinder wachsen ohne selbstverständlichen Kontakt zu Wiesen, Wäldern oder wilden Tieren auf.
Verpasste Gesundheitschancen
Die Folgen reichen über individuelles Unbehagen hinaus. Wer Natur meidet, verzichtet auch auf ihre gut belegten gesundheitlichen Effekte. Zahlreiche Studien zeigen, dass Aufenthalte im Grünen Stress reduzieren, die Konzentration fördern und sich positiv auf die emotionale Entwicklung von Kindern auswirken können. Biophobie schneidet Menschen von diesen Ressourcen ab.
Zugleich hat die Abneigung ökologische Konsequenzen. Negative Gefühle gegenüber bestimmten Tier- oder Pflanzenarten begünstigen ablehnende Haltungen, selbst wenn diese Arten harmlos oder ökologisch wertvoll sind. Auf gesellschaftlicher Ebene kann das Unterstützung für Naturschutz und Biodiversität untergraben.
Wege zurück zur Natur
Die gute Nachricht: Biophobie ist kein Schicksal. Die Forschenden betonen, dass gezielte Gegenmaßnahmen wirken können, vor allem wenn sie früh ansetzen. Positive Naturerfahrungen im Kindesalter gelten als besonders wirksam. Auch naturnah gestaltete Städte mit vielfältigen Grünräumen können Hemmschwellen senken und neue Berührungspunkte schaffen.

Entscheidend sei, so Jensen, die Mechanismen hinter den negativen Emotionen besser zu verstehen. In manchen Fällen helfe Wissen, in anderen die schrittweise Annäherung oder das Entschärfen realer Konflikte zwischen Mensch und Natur. Biophobie sei kein einheitliches Phänomen, sondern ein breites Spektrum – entsprechend vielfältig müsse auch der Werkzeugkasten sein.
Die systematische Übersicht aus Lund plädiert daher für einen Perspektivwechsel in der Forschung: weg von der stillschweigenden Annahme einer durchweg positiven Naturbindung, hin zu einem realistischeren Bild menschlicher Gefühle. Zwischen Zuneigung und Abwehr, zwischen Faszination und Furcht entscheidet sich, wie wir Natur künftig wahrnehmen und wie gut es gelingt, sie zu bewahren.