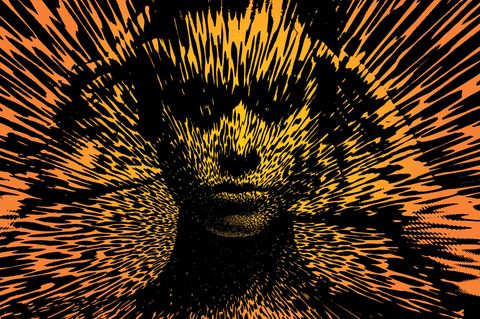Plötzlich treten Flimmerkränze im Sichtfeld auf, Zickzackfiguren aus gleißendem Licht. Betroffene von Migräne wissen Bescheid, was nach diesen vorübergehenden neurologischen Symptomen geschieht. Nach dieser sogenannten Aura, manche sehen auch Objekte verzerrt und unscharf, erleiden Gesichtsfeldausfälle oder Empfindungsstörungen, tritt die eigentliche Migräneattacke auf. Häufig wird der Schmerz von Übelkeit begleitet, einige müssen sich erbrechen, viele berichten von einer Empfindlichkeit gegenüber Lichtreizen oder Gerüchen.
Laut WHO ist die Migräne, mit oder ohne Aura, die dritthäufigste Erkrankung der Welt, die mit hohem Leidensdruck im Alltag einhergeht. Wissenschaftler der Universität Kopenhagen haben in einer neuen Studie einen unbekannten Signalweg im Gehirn entdeckt, der die Anfälle erklären könnte und Hoffnung auf effektive Migräne-Medikamente befördert.
Lücke in der Blut-Hirn-Schranke gefunden
Martin Rasmussen und sein Team von der Universität Kopenhagen untersuchten dazu Mäuse, die Migräneschübe mit Aura durchleiden und entdeckten einen bisher unbekannten Signalweg. Sie nutzten auch verschiedene bildgebende Verfahren und führten eine Proteinanalyse der Mäuse per Massenspektrometer durch.
Sie stießen auf ein im Zusammenhang mit Migräne bekanntes Hirnprotein, das bei Attacken mit Aura vermehrt im Hirnwasser freigesetzt wird, das Protein CGRP (Neuropeptid Calcitonin Gene-Related Peptide). Dabei handelt es sich um ein aus 37 Aminosäuren bestehendes Neuropeptid. Insgesamt werden bei einer Migräneattacke zwölf verschiedene Proteine in das Hirnwasser freigesetzt, wie die Forschenden ebenfalls feststellten. Der Signalweg erfolgt nun über einen bestimmten Nerven-Knotenpunkt außerhalb des Gehirns, den Ganglion trigeminale. An diesem Nervenknoten trennt sich der Trigeminus-Nerv in drei Äste auf, die in das Gesicht und den Kopf ziehen. Der Punkt ist zentral für die Schmerzsignalverarbeitung.
An diesem Nervenknotenpunkt ist die Blut-Hirn-Schranke durchlässig, wie die dänischen Forschenden erstmals als zentrale Erkenntnis feststellten.
Ausnahmsweise können so periphere Nervenzellen mit dem vorbeifließenden Protein CGRP und weiteren Proteinen im Hirnwasser in Kontakt treten. Der Protein-Mix bindet dann an die Nervenzellen, was die Schmerzempfindungen und Wahrnehmungsstörungen bei Aura-Patienten hervorruft, wie die Forschenden im Magazin "Science" berichten.
Pharmakologische Hoffnungen
Die Wissenschaftler glauben, dass sie den primären Kommunikationskanal zwischen dem Gehirn und dem peripheren sensorischen Nervensystem (PNS) identifiziert haben, der bis zu diesem Zeitpunkt unbekannt war. Dieses Studienergebnis könnte die Forschung für Migräne-Medikamente ebnen, die vor allem auf diesen Signalweg fokussieren und das Protein CGRP hemmen. Rasmussen sagte: "Die Definition der Rolle dieser neu identifizierten Protein-Rezeptor-Paare könnte die Entdeckung neuer pharmakologischer Ziele ermöglichen, die dem Großteil der Patienten zugutekommen könnten, die auf die bisher verfügbaren Therapien nicht ansprechen."
Zur Selbsthilfe: Kopfschmerztagebuch führen
Um die individuelle Schmerzdynamik besser zu verstehen, empfehlen Experten, ein Kopfschmerztagebuch oder einen Kopfschmerzkalender zu führen. Vorlagen gibt es im Internet zum Selberausdrucken. Noch praktischer sind entsprechende Smartphone-Apps – oft kostenlos und von Krankenkassen und Kliniken entwickelt.
Das Prinzip ist dabei immer das Gleiche: Jede Schmerzattacke wird in all ihren Details erfasst. Es gilt, die Symptome genau zu beobachten und zu beschreiben. Zieht es in der Stirn oder drückt es am Hinterkopf? Pocht der Schmerz einseitig hinter dem Auge oder umspannt er den ganzen Schädel? Gibt es Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Sehstörungen oder Lichtempfindlichkeit?
Neben Art, Stärke und Dauer des Schmerzes sollten Medikamente sowie mögliche Auslöser, etwa Stress, Schlafverhalten, Sport, Menstruation, Rauchen, Kaffeekonsum oder die genaue Ernährung im Kopfschmerztagebuch festgehalten werden.
In den meisten Apps lassen sich zudem statistische Auswertungen und Grafiken zum Krankheitsverlauf erstellen. In der "Migräne-App" der Schmerzklinik Kiel etwa können Nutzer herausfinden, wie hoch ihr Risiko für chronischen Kopfschmerz ist, unter welcher Art von Kopfschmerz sie leiden, und sie finden einen Schnelltest zur Bestimmung des optimalen Zeitpunktes für die Einnahme bestimmter Akutmedikamente.
Vor allem aber erleichtert die Dokumentation Ärzten die Diagnose. Denn je genauer und umfassender das Bild des Schmerzes ist, desto leichter kann ein Mediziner die passende Behandlung festlegen. Daher raten Experten, schon vor dem ersten Arztbesuch mit den Aufzeichnungen zu beginnen.