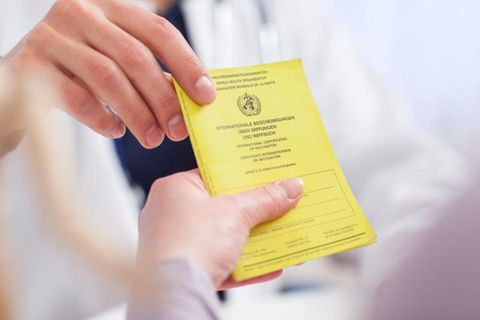GEO: Der Begriff des "Sekundären Ertrinkens" hält sich hartnäckig. Was wird unter diesem Begriff allgemein verstanden?
Prof. Dr. Peter Radke: Der Begriff beschreibt das Phänomen, dass im Nachgang an einen Bade- oder Ertrinkungsunfall ein Mensch stirbt - gar nicht an dem Ertrinken selber, sondern an einer Folge des Wasseratmens.
Der Ausdruck gewann vor einiger Zeit besondere Bekanntheit, weil Einzelfälle von Kindern durch die Presse gingen, die einige Tage nach einem Badeunfall plötzlich Zuhause verstarben. Das sind jedoch glücklicherweise sehr wenige - weniger, als die Berichte in den Medien suggerieren.
Weltweit ertrinken jährlich rund 372.000 Menschen, vor allem in Asien und Zentralafrika. In Deutschland sterben jährlich etwa 500 Menschen durch Ertrinken. Die meisten davon sind zwischen 21 und 90 Jahren und sterben im Krankenhaus – entweder in Folge einen schweren hypoxischen Hirnschadens oder eines Herz-Kreislauf-Versagens. Unter den restlichen Todesfällen der 0 bis 20-jährigen (71 Fälle im Jahr 2018), sind die Fälle, in denen Kinder zuhause plötzlich tot im Bett liegen, extrem selten.