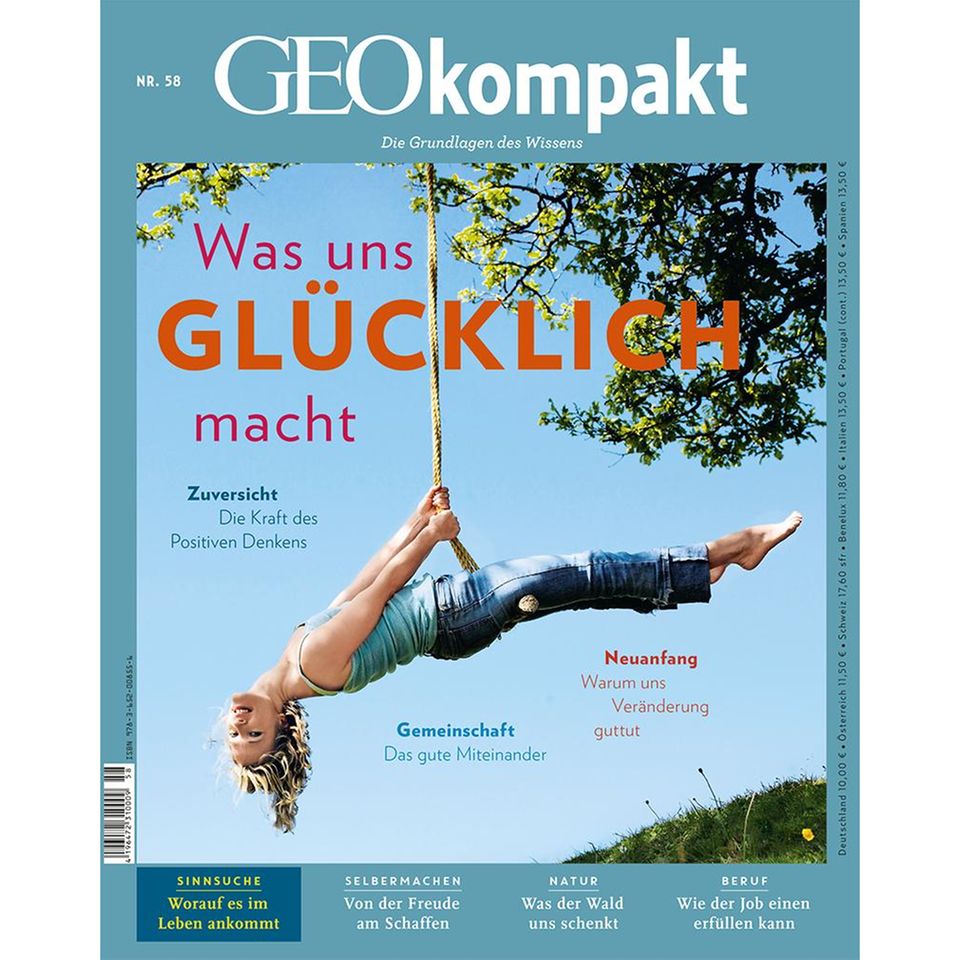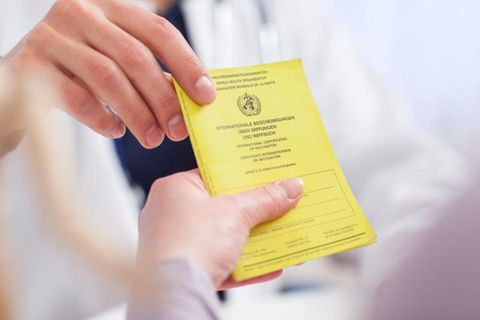Die meisten Menschen – selbst viele ausgewiesene Schwarzseher – bergen in ihrem Inneren einen Schatz: eine tief in ihrem Charakter verankerte, individuell ganz unterschiedlich stark ausgeprägte Zuversicht. Wissenschaftler sprechen vom „dispositionellen Optimismus”.
Das Besondere daran: Es handelt sich um eine mentale Kraft, die sich mit gezielten Übungen stärken lässt. Etwa mit der „Best possible self”-Methode. Dabei beschäftigt man sich (entgegen der bei vielen Pessimisten gewohnten Tendenz) mit dem bestmöglichen Selbst.
Positives Denken lässt sich trainieren
Konkret geht es darum, eine ganz private, positive Vision zu formulieren: zum Beispiel, wie eine Zukunft aussähe, in der beruflich gesteckte Ziele erreicht werden. Wichtig ist es, die Wunschvorstellung schriftlich und detailreich festzuhalten. Anschließend stellt man sich das Szenario gedanklich fünf Minuten vor und wiederholt dies zwei Wochen lang täglich. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass allein schon die Beschäftigung mit dieser bestmöglichen Zukunftsvariante einen deutlich positiven Effekt auf Wohlbefinden und Optimismus hat. Nicht wenige empfinden sie als ersten wichtigen Schritt in die gewünschte Richtung.
Eine andere Übung stammt aus der Sportpsychologie. Sie vermag die Zuversicht besonders für bevorstehende Stresssituationen zu steigern. Die Idee: Viele Athleten, die vor einem Wettkampf stehen, simulieren bereits im Training den psychisch anstrengenden Ernstfall, etwa einen Skiabfahrtslauf. Um den dazu nötigen positiven Stress aufzubauen, geben sie sich eine Prognose der eigenen Leistungsfähigkeit. Das Ziel ist also zum Beispiel, im Training eine bestimmte, besonders schnelle Zeit zu erreichen.
Hat der Sportler mit diesem künstlich erzeugten Druck sein Training absolviert, wird analysiert, wie sich der bewährt hat: Wurde das Ziel erreicht? Könnte es beim nächsten Mal höher angesetzt werden? Oder ist der Versuch missglückt? Sollte deshalb eine spezielle Fertigkeit geübt oder das Ziel anders gesetzt werden? Langfristig lernen die Athleten so, sich realistisch einzuschätzen – können auch unter schwierigen Bedingungen ihre optimale Leistung abrufen.
Zuversicht durch Übung steigern
Auch Menschen, die keinen Leistungssport betreiben, können diese Methode nutzen, um etwa ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Sie können das anstehende Jobgespräch vorab proben – zum Beispiel mit einem Freund, der die Rolle des Interviewers übernimmt. Zudem lassen sich weitere Stressbedingungen auswählen. Wenn es vielleicht um einen Vortrag geht, kann man während der Probe vor Publikum sprechen. Auch sollten Ziele gesetzt sein: ohne Ablesen vorzutragen oder eine bestimmte Zeit einzuhalten.
Wer sich so vorbereitet, für den Ernstfall übt, erkennt eigene Stärken und Fehler, kann sich im Training verbessern. Und steigert seine Zuversicht, dass es auch in der echten Belastungssituation gelingen wird, das Ziel zu erreichen. Scheitert dennoch hin und wieder ein Vorhaben, neigen viele Menschen zu negativen Verallgemeinerungen. Sie stellen dann bisweilen ganz grundsätzlich ihre Begabungen oder ihre Intelligenz infrage.
Oft wurzeln derartige Pauschalisierungen in Kindheit und Jugend. Damit sich diese pessimistischen Denkmuster und Betrachtungsweisen nicht schon früh im Lauf der Entwicklung verfestigen, haben Forscher zahlreiche Schulungen zur Prävention entwickelt. Eines der wissenschaftlich am besten untersuchten Konzepte ist das an der University of Pennsylvania konzipierte „Penn Resiliency Program”, das sich an Kinder und Jugendliche richtet und deren Resilienz verbessern soll – ihre innere Widerstandskraft.
Negative Gedanken und Denkmuster durch positive Gedanken ersetzen
Das Programm geht pessimistische Denkschemata mit Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie an. Ziel ist es, einen „optimistischen Erklärungsstil” zu entwickeln, also negativ geprägte Denkmuster (etwa bei einem schlechten Prüfungsergebnis: „Ich bin dumm”) durch positive („Ich war schlecht vorbereitet, beim nächsten Mal kann ich es vielleicht besser machen”) zu ersetzen.
In den Sitzungen lernen die Teilnehmer, angenehme und unangenehme Ereignisse objektiv zu beschreiben. Sie machen sich bewusst, was Menschen bei bestimmten Vorfällen (der Trainer im Sportverein schimpft) in der Regel denken und fühlen. Anschließend wird ein sinnvoller Umgang mit solchen Angriffen, Missgeschicken und Fehlschlägen vermittelt und geübt. Die zentrale Botschaft: Man kann ein und dasselbe Erlebnis auf hilfreiche oder schädliche Weise interpretieren. Überzogen kritische Worte etwa sind oft einem Missverständnis oder schlechter Laune geschuldet – und nicht zwangsläufig persönlich zu nehmen. Zudem lernen die Heranwachsenden, wie sie sich entspannen, Probleme lösen, zu Entscheidungen finden, mit anderen verhandeln oder sich durchsetzen: damit sie häufiger jene Erfolgserlebnisse haben, ohne die wohl auch die raffiniertesten Denkstrategien keine dauerhafte Zuversicht erzeugen können.
Welche Methode für mehr Optimismus man auch verfolgt: Immer erfordert es viel Geduld und regelmäßige Übung, bis sich eingefahrene Denkmuster ändern. Doch das Gehirn ist, wie Neuroforscher inzwischen wissen, bis ins hohe Alter hinein erstaunlich flexibel. Gleichsam wie ein Muskel braucht es nur das richtige Training und viel Zeit, um sich in gewünschter Weise zu wandeln.