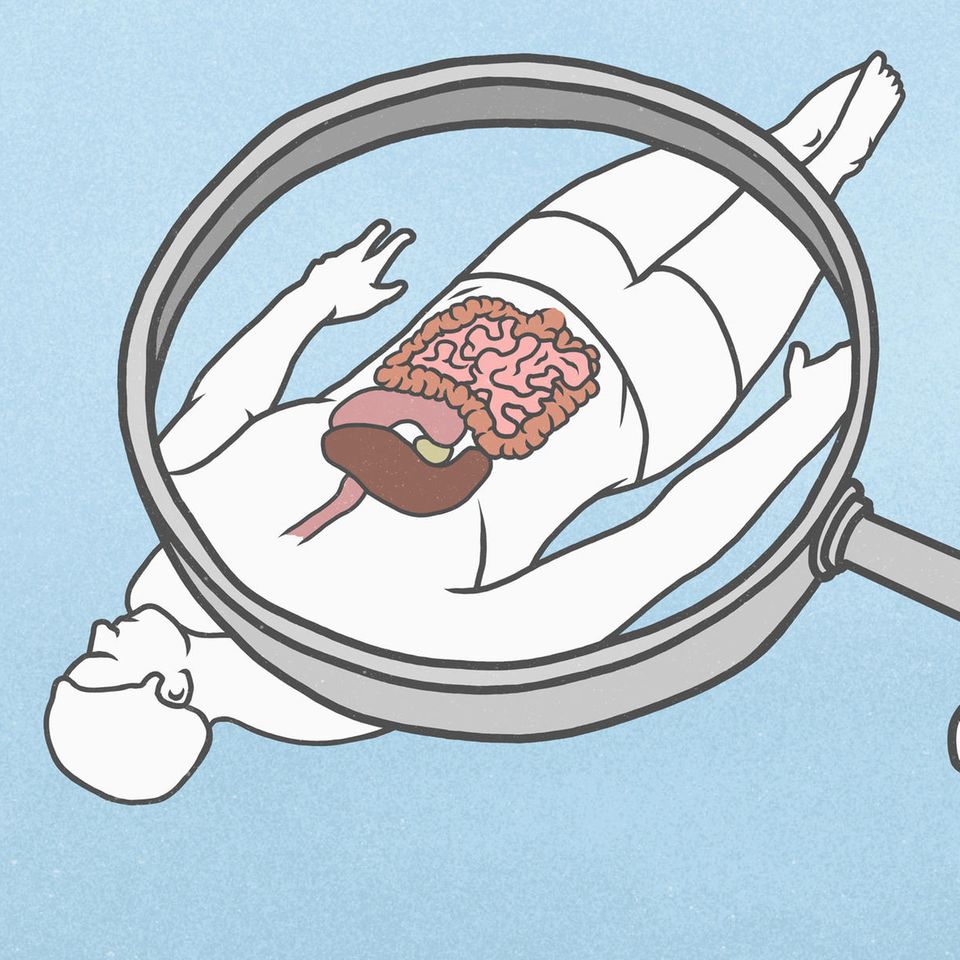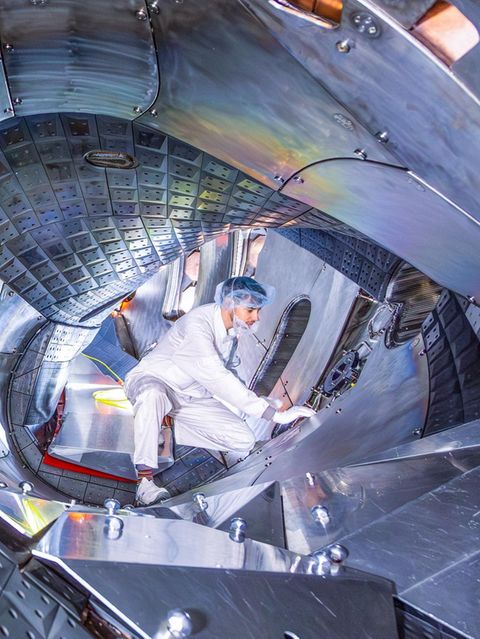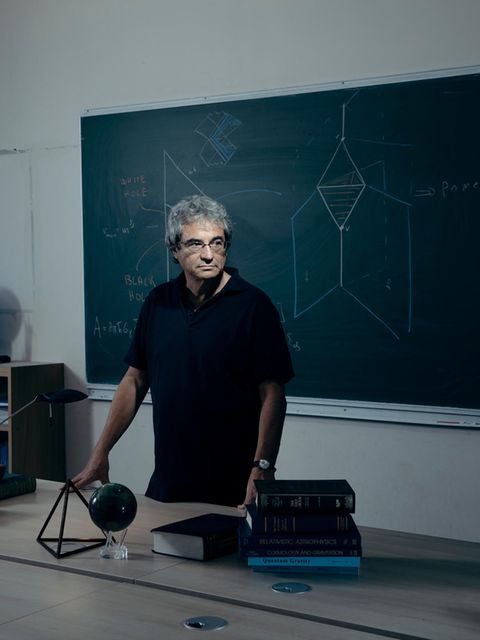Wer einen Hund besitzt, kann es bestätigen: Die Tiere tun uns gut. Die Gesellschaft, das Kuscheln und Spielen senken unseren Stressspiegel, und die Lebewesen schenken uns Bestätigung und einen Sinn, wenn wir für sie Verantwortung übernehmen. Womöglich tun die Tiere uns aber noch ganz anders gut, auf eine Weise, die zunächst unappetitlich klingt. Hunde verändern die Zusammensetzung der Mikroben, die in und auf unserem Körper leben, und diese Mikroben wiederum könnten unsere psychische Gesundheit positiv beeinflussen. Dies behauptet ein Forschungsteam verschiedener japanischer Universitäten in einer Studie, die nun in der Fachzeitschrift "iScience" erschienen ist.
Frühere Studien haben gezeigt, dass junge Menschen, die von klein auf mit einem Hund aufwachsen und auch später im Leben Hunde halten, ein besseres mentales Wohlbefinden und weniger problematische Verhaltensweisen aufweisen: weniger soziale Probleme, weniger Rückzug und Zwangsstörungen, weniger delinquentes (etwa Lügen und Beleidigen) oder aggressives Verhalten. Zugleich stiegen die Werte für Kameradschaftlichkeit und soziale Unterstützung.
Symbiotische Mikrobengemeinschaft
Andere Studien wiesen nach, dass Hundehaltende Unterschiede in ihrem Darmmikrobiom aufweisen, darunter eine größere mikrobielle Vielfalt. Herrchen, Frauchen und Tier leben also in einer symbiotischen Mikrobengemeinschaft. Da Darm und Gehirn über die Darm-Hirn-Achse aufeinander Einfluss nehmen, liegt die Hypothese nahe, dass ein geändertes Darmmikrobiom teilweise für die positiven Effekte auf den Menschen verantwortlich sein könnte.
In der vorliegenden Studie untersuchten die Forschenden 14-Jährige aus der Metropolregion Tokio. Jugendliche, die im Alter von 13 einen Hund besaßen, zeigten im Durchschnitt eine bessere psychische Gesundheit. Soziale Probleme waren bei ihnen deutlich seltener als bei Jugendlichen ohne Hund.
Als Nächstes untersuchten die Forschenden Mikrobiomproben aus dem Mund von Jugendlichen. Nach der Sequenzierung der Mikroben stellten die Forschenden eine ähnliche Artenvielfalt und -fülle bei beiden Gruppen von Jugendlichen fest. Die Zusammensetzung des Mikrobioms wies jedoch Unterschiede auf.
Um zu zeigen, dass einige dieser Bakterien das Verhalten der Jugendlichen ändern könnten, übertrugen die Forschenden die Mikroben auf Labormäuse und beobachteten deren Sozialverhalten. Es stellte sich heraus, dass Mäuse mit dem Mikrobiom von Hundebesitzern mehr Zeit damit verbrachten, an ihren Käfiggenossen zu schnüffeln. Auch erhielt ein Artgenosse, der separat eingeschlossen war, vermehrt Aufmerksamkeit. Die Forschenden interpretieren das als gesteigertes soziales und empathisches Verhalten.
Darmmikrobiom beeinflusst wohl die Psyche
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Mikroben der Hunde zumindest teilweise für die sozialen und psychischen Verhaltensweisen der Jugendlichen verantwortlich sein könnten. Dennoch bleibt schwierig festzumachen, ob zwischen Verhalten und Mikrobiom nur eine Korrelation oder eine Kausalität besteht. Beispielsweise muss das häufigere Schnüffeln der Mäuse kein soziales Verhalten sein, sondern es könnte bloß für mehr Neugierde sprechen. Auch zeigten nicht Mäuse jedes Alters das Verhalten.

Unklar ist auch, ob die Ergebnisse auf andere Bevölkerungsgruppen und Kulturen übertragbar sind. Auch wenn die Forschenden versuchten, sozioökonomische Faktoren herauszurechnen, war die Gruppe der Versuchsteilnehmenden sehr homogen. Die Jugendlichen aus der Metropolregion Tokio haben einen sozioökonomisch höheren Status als die Gesamtbevölkerung Japans, was ihr Sozialverhalten prägt.
Offen ist auch, wie genau sich das Mikrobiom der Hundehaltenden anpasst. In Haushalten mit Hunden zeigt sich an vielen Orten eine höhere und vielschichtigere Sammlung von Mikroben. Diese könnte also vom Hund auf einen Gegenstand und dann auf den Menschen übertragen worden sein. Aber auch der direkte Kontakt, etwa das Abschlecken des Menschen durch den Hund, lässt Mikroben herüberwandern. Andererseits könnte sich das Mikrobiom der Menschen auch indirekt verändern: Wenn die Gegenwart des Hundes ihr Stresslevel und damit beispielsweise ihren Cortisolspiegel senkt, verändert dies wiederum die Zusammensetzung ihres Darmmikrobioms.
Bei alldem soll die Studie keine Einladung sein, Hunde zu küssen. Denn dabei können nicht nur krank machende Mikroben übertragen werden. Das artfremde Verhalten kann bei Tieren auch Stress verursachen, manche lassen es nur ungern über sich ergehen. Auch wenn manche Halter*innen die Stressreaktion vermenschlichend als niedlich deuten.