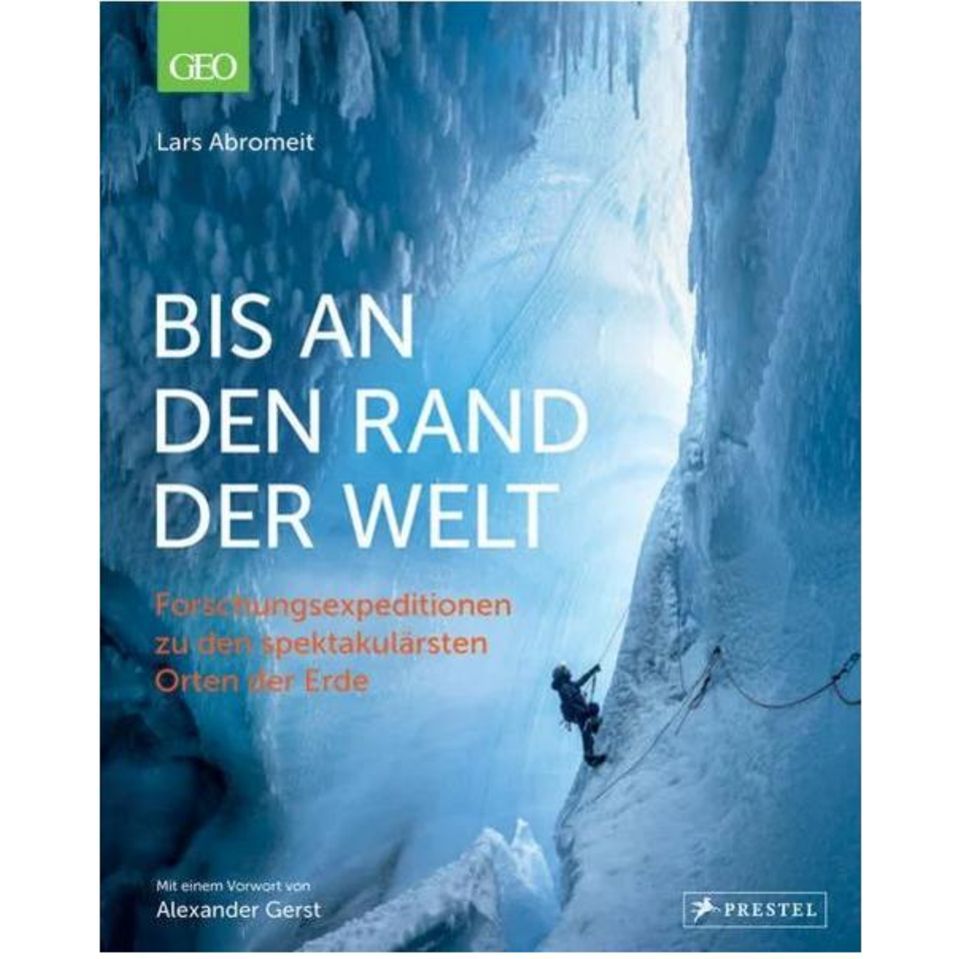Mitten in der rostroten Felswand, an der wir uns zwischen Moosen, Bromelien und Fleischfresserpflanzen abgeseilt hatten, klaffte ein dunkles Loch, groß wie ein Kirchenportal: ein Zugang zur Unterwelt – in einen lichtlosen, seit Jahrmillionen abgeschiedenen Kosmos des Lebens.
Nur per Hubschrauber hatten wir es hierher, zum Gipfelplateau des Sarisariñama, geschafft. Dieser Felsklotz ist ein "Tepui", einer der mehr als 100 sagenumwobenen Tafelberge, die im Grenzgebiet zwischen Venezuela, Brasilien und Guayana schroff und entlegen aus Savannen und Regenwäldern herausragen.
Als Reste eines gigantischen Sandsteinplateaus, das vor rund 1,7 Milliarden Jahren entstand, zählen die Tepuis zu den ältesten Landschaften der Erde. Viele Gipfelplateaus liegen so isoliert, dass sich Tiere und Pflanzen hier seit der letzten Epoche der Dinosaurier weitgehend eigenständig entwickelt haben. Und die meisten der Canyons und Höhlensysteme, die in das Innere dieser Berge führen, hat bislang nie ein Mensch betreten.
Tief in der Unterwelt die Entdeckung: "Lebende Steine"
Mit einem Forschungsteam um den italienischen Geologen Francesco Sauro wollten wir 2016 am Sarisariñama genauer herausfinden, wie diese unterirdischen Labyrinthe im harten Quarzitgestein der Tepuis entstehen konnten – und welche Lebensformen sich hier verbergen. Also schlugen wir uns mit Macheten einen Weg durch den tropischen Wald auf dem Gipfelplateau, seilten uns in verborgenen Schächten ab, stolperten unter Tage durch Flüsse und über Haufen aus brüchigem Fels, krochen durch Spalten, in denen Skorpione und handtellergroße Geißelspinnen lauerten.
Bis wir, tief in der Unterwelt, plötzlich auf eigenartige, meterhohe Skulpturen stießen: Einige sahen wie versteinerte Pilze aus, andere wie Korallenriffe, die bei der kleinsten Berührung zerfielen. Es waren Stromatolithen – Mikrobenstaaten, die Mineralien als Stützgerüste verwenden. "Lebende Steine"!
Erdgeschichtlich betrachtet, war diese Entdeckung sensationell. Denn Stromatolithen beherrschten die Erde vor etwa einer Milliarde Jahren. Sie starben weitgehend aus, als sich in den Urmeeren die ersten komplexeren Lebewesen entwickelten, und sind gegenwärtig nur noch von wenigen Orten an der sonnendurchfluteten Oberfläche bekannt, den Küstengewässern von Westaustralien zum Beispiel. Wie hatten diese Bakterienkolonien, die Francesco Sauro auch in den Höhlensystemen von anderen Tepuis gefunden hatte, hier in der nährstoffarmen und lichtlosen Unterwelt überleben können?

Erst sieben Jahre später, im Frühjahr 2023, konnte ich mit den Geologen um Sauro zu den Tepuis zurückkehren. Diesmal begleitete auch eine Mikrobiologin das Team: Martina Cappelletti von der Universität Bologna baute in einem Höhlensystem unter Tage in einem Zelt ein Genetiklabor auf, um dort Proben der Stromatolithen genauer zu untersuchen. Wir alle fieberten mit, ob die Analyse gelingen würde: Und tatsächlich fand Cappelletti heraus: Die Mikrobengemeinschaften der lebendigen Steine bestehen aus mehreren Bakterienformen, die wie ein "Superorganismus" symbiotisch zusammenarbeiten. Einige ziehen Nährstoffe aus dem Fels, andere aus der Luft. So gelingt es ihnen, auch fern des Sonnenlichts zu überleben; allerdings wachsen sie dabei nur sehr, sehr langsam: rund einen Zentimeter in etwa 10.000 Jahren.
Die DNA-Analyse bewies aber auch: Einige der Mikroben sind vielversprechende Kandidaten für die Entwicklung neuartiger Medikamente. Aus Substanzen, mit denen die lebenden Steine sich in der Tiefe gegen Nährstoffkonkurrenten verteidigen, lassen sich womöglich Antibiotika erzeugen. Die Forschung setzt große Hoffnung auf solche Wirkstoffe aus extremen, fremdartigen Umgebungen. Denn gegen sie können Krankheitserreger wie Staphylokokken oder Tuberkulosebakterien nicht so schnell Resistenzen ausbilden.
Steine aus den Tepui-Höhlen könnten zur Apotheke der Menschheit werden
Es ist eine unerwartete Hilfe: Die lebenden Steine aus den Tepui-Höhlen könnten in Zukunft zu einer Apotheke der Menschheit werden. Aber der Weg zu ihrer Entdeckung war lang und mühsam – wie mühsam genau, lässt sich in der TV-Dokumentation nachverfolgen, die der Filmemacher Jochen Schmoll und ich im Auftrag des ZDF von der Reise mit unserem Team erstellt haben.
Neue Naturschutzgebiete, Substanzen für Antibiotika und zur Krebstherapie: Ungeahnte Erfolge können aus Expeditionen hervorgehen. Meistens aber entstehen solche Erkenntnissprünge erst im Zusammenspiel Dutzender Feldforschungsinitiativen von Wissenschaftsteams weltweit. Und oft dauert dieser Prozess viele Jahre, der Anteil der einzelnen Expeditionen daran ist dann schwer zu berechnen: Oft müssen wir Rückschläge überstehen, uns immer wieder auf neue Ziele einstellen und neue Techniken entwickeln.
Es zählt zum Wesen von Expeditionen, dass sie ihr Ziel auch verfehlen können. Wer hinausgeht ins Unbekannte, braucht Ausdauer und Geduld. Zwischendurch zu scheitern, zu stolpern und doch wieder aufzustehen: Das gehört dazu. Umso erstaunlicher ist es, wie fahrlässig wir als Gesellschaft mit vielen Erkenntnissen umgehen, die Forschende in Extremgebieten der Erde mühsam und unter großen Risiken für uns gewinnen. Wie in der Klimaforschung zum Beispiel.

Nach welchen Gesetzen sich Windsysteme und Temperaturen, Dürren und Überflutungen weltweit entwickeln, lässt sich nur dann gut berechnen, wenn Meteorologen dabei auch Langzeitdaten des Klimas aus abgelegenen Weltregionen in ihre Computermodelle einbeziehen. In Ny-Ålesund auf Spitzbergen etwa, dem nördlichsten Dorf der Erde, zeichnen Polarforschende seit mehr als 30 Jahren akribisch Wetterdaten der Arktis auf.
Im vorvergangenen Winter durfte ich sie besuchen: Selbst in der Polarnacht, bei monatelanger Dunkelheit, Schneestürmen und der Gefahr, einem hungrigen Eisbären über den Weg zu laufen, prüfen die Frauen und Männer täglich Temperaturen, Luftdruck- und Strahlungsparameter. Ihre Studien belegen, dass die rasant steigenden Temperaturen der Arktis auch weltumspannende Wettersysteme wie den Jetstream und den Monsun beeinflussen – und dass dadurch Extremwetterlagen in Zukunft häufiger werden.
Schon seit Jahren sind diese Gefahren des Klimawandels global bekannt. Und doch reagieren wir als Weltgemeinschaft darauf nur sehr zögerlich: Ist das nicht ungeheuer respektlos den Forschenden gegenüber, die in der Einsamkeit ausharren, ihre Gesundheit und gar nicht selten ihr Leben riskieren, um für uns die Zusammenhänge der Welt zu durchschauen?
Für viele Entwicklungen unseres Heimatplaneten wären wir ohne sie taub und blind. Als erste Generation in der Menschheitsgeschichte verfügen wir, unter anderem dank der Feldforschung, über das Wissen, komplexe Prozesse wie den Klimawandel relativ gut zu durschauen. Ich finde: Aus diesem Wissen erwächst auch die Pflicht, es zu nutzen – entschieden und schnell. Das sind wir den kommenden Generationen schuldig, die mit den Entscheidungen leben müssen, die wir heute treffen.
Expeditionen sind nur so erfolgreich, wie das, was wir aus ihnen machen. Und vielleicht ist das die wichtigste Einsicht aus unseren Reisen wie jener zum Raja-Ampat-Archipel, in die Arktis oder zu den Tepuis von Venezuela: Was in der Ferne geschieht, betrifft uns auch hier zu Hause.
Das Schicksal der Arktis, das von Korallenriffen oder von Höhlenmikroben kann unser Leben verändern. Wenn Forschungsteams von den Reisen ins Unbekannte zurückkehren, ihre Erkenntnisse mit uns teilen und daraus Empfehlungen ableiten, lohnt es sich deshalb, auf sie zu hören.