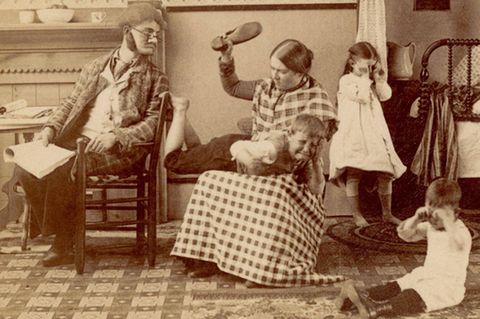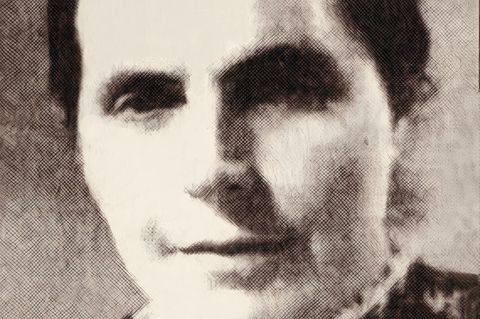GEO: Frau Dr. Peuke, Sie haben Interviews ausgewertet, in denen in der DDR Geborene mit Kindern über ihre Kindheit sprechen. Welche Muster haben Sie dabei ausgemacht?
Dr. Julia Peuke: Unter anderem, dass die Eltern kaum vorkommen in den Interviews. Wenn sie erwähnt werden, geht es oft darum, dass man um 18 Uhr zusammen Abendbrot gegessen hat. Aber vor allem findet die Kindheit in Kindergruppen statt, unabhängig von den Eltern. Da zeigt sich die umfassende institutionelle Betreuung von Kindern in der DDR.
Wird die Abwesenheit der Eltern bedauert?
Nein. Vielmehr kommt in etlichen Erzählungen positiv heraus, dass man viel zusammen mit anderen Kindern war. Etwa bei Kinder- und Jugendorganisationen wie den Jungen Pionieren und der Freien Deutschen Jugend. Das Politische dieser Organisationen, die sozialistische Ideale vermitteln sollten, spielt dabei übrigens kaum eine Rolle. Beschrieben werden Halstücher und Fahnenappelle. Über dieses Symbolhafte geht es nicht hinaus. Im Fokus steht die Gemeinschaft, dass man zusammen schöne Nachmittage verbracht hat.
Das heißt, die politische Indoktrination der Kinder ist gescheitert?
Gemessen an diesen Interviews vielleicht. Dass das Gemeinschaftliche betont und das Politische ausgeklammert wird, kann aber auch eine Entlastungsstrategie sein. Nach dem Motto: Wir haben das alle gemacht, das war halt damals so.

Was genau war das Ziel des Staates in der Kindererziehung?
Kinder sollten zu überzeugten Sozialisten heranwachsen. Darauf sollte jegliche Art von Erziehung ausgerichtet sein, im institutionellen wie im privaten Rahmen. Die DDR-Regierung sah es als wichtig an, Kindern ihre politische Doktrin früh mitzugeben. Das galt als Schlüssel, um die staatliche Ideologie zu festigen und zu verstetigen.
Wie wurde das in der DDR umgesetzt?
Die Kinder kamen sehr früh in die Krippe, zum Teil im Alter von wenigen Wochen. Das hatte einerseits wirtschaftliche Gründe, die Mütter wurden als Arbeitskräfte gebraucht. Aber es ging eben auch darum, die Heranwachsenden so bald wie möglich auf Gemeinschaftlichkeit auszurichten. Es gab klare Vorgaben durch den Staat zur sozialistischen Persönlichkeitsbildung. Zum Beispiel sollten sie im Alter von drei Jahren ihre Gefühle steuern und andere Kinder auf fehlerhaftes Verhalten hinweisen können. War das individuelle Entwicklungstempo von einzelnen Kindern langsamer als die Gruppennorm, etwa beim Benennen von Farben oder beim Besteckhalten, wurde ihnen auch Widerständigkeit zugeschrieben. Individualismus galt wenig, das Kollektiv viel. Und auch die politische Indoktrination begann im Krippen- und im Kindergartenalter.
Wie muss man sich das vorstellen?
Es gab bestimmte Kinderlieder, die Programm waren, etwa "Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee". Kinder sollten in Kontakt mit militärischem Spielzeug kommen, Panzer zum Beispiel. Im Vorschulalter sollten sie etwas über Ernst Thälmann und Wilhelm Pieck als kommunistische Vorbilder erfahren. Es existierten umfangreiche Bildungspläne auch für Kleinkinder. In die Krippen und Kitas kamen Kontrolleure, um zu überprüfen, ob die Vorgaben umgesetzt wurden.
Reichte der Griff des Staates auch in die Familien hinein?
Zumindest stand in der Verfassung der DDR und im Jugendgesetz, dass Eltern sozialistische Prinzipien sowie die Liebe zum Vaterland an ihre Kinder weitergeben sollen. Aber das konnte in den Familien natürlich niemand so kontrollieren wie in den Institutionen. In der Forschung existierten dazu lange zwei sehr unterschiedliche Thesen. Zum einen, dass die Familie ein privater, vom ideologischen Überbau kaum beeinflusster Raum war. Zum anderen, dass die Parolen des Staates die Erziehung in den Familien stark prägten. Mittlerweile ist sich die Forschung weitgehend einig, dass beide Thesen zu radikal waren und die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. So werden manche Familien sehr politisch erzogen haben, während andere sich komplett ins Private zurückzogen. Man kann das nicht verallgemeinern.

In der jungen Bundesrepublik waren die autoritären Erziehungsmethoden aus dem Nationalsozialismus noch weit verbreitet. War die DDR in diesem Punkt fortschrittlicher?
Die eigene Erziehung wirkt immer nach. Es spricht viel dafür, und das sehen wir auch in Studien und Quellen, dass in den 1950er-Jahren klare Hierarchien galten und man eher einem autoritären oder strengen Erziehungsstil folgte, weniger einem Verhandlungsstil. Die Erwachsenen gaben also den Ton an, und die Kinder hatten zu gehorchen. So hatten es viele Eltern in ihrer eigenen Kindheit in den 1920er- und 1930er-Jahren erfahren, und so, beziehungsweise ähnlich verhielten sie sich gegenüber ihren Kindern. Kinder galten grundsätzlich als formbar, nicht als eigenständige Persönlichkeiten.

In Westdeutschland änderte sich der autoritäre Erziehungsstil maßgeblich durch die 68er. Welche Auswirkungen hatten sie auf die Erziehung in der DDR?
Das, was wir als die Erfahrungen der 68er-Zeit bezeichnen – Umbruch, Demokratisierung, Liberalisierung bestimmter Werte –, gab es in der DDR nicht in der Weise wie in Westdeutschland, obwohl sich auch dort in den 1970er- und 1980er-Jahren manche Formen von Liberalisierung vollzogen. Bezogen auf die Institutionen spielte das aber eher keine Rolle. Denn der Staat hatte just in dieser Zeit seinen Einfluss auf Erziehung und Bildung abermals gefestigt. 1965 wurde das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem verabschiedet, das die eben besprochenen Prinzipien in Krippe, Kitas und Schulen festschrieb. Da blieb alles in geregelten Bahnen. In den Familien sieht es ein bisschen anders aus. Da zeigen individuelle Erfahrungsberichte, dass diejenigen, die ab den späten 60er-Jahren geboren wurden, liberaler erzogen wurden als die Älteren. Disziplin und Strenge blieben zwar wichtig, aber die Eltern gewährten etwas mehr Freiheiten. Allerdings war der Wandel längst nicht so groß und deutlich wie in der Bundesrepublik.